Der Gesetzesentwurf zur Rehabilitierung homosexueller Soldat*innen lässt weiten Raum für dringend notwendige Nachbesserungen und scheint eher dünnes Symbölchen als Übernahme der Verantwortung für Diskriminierung zu sein. Ein Kommentar.
Bereits im November 2020 wurde im Bundeskabinett das Gesetz zur Rehabilitierung diskriminierter homosexueller Angehöriger der Bundeswehr und NVA (Nationale Volksarmee der DDR) beschlossen. Bei aller Zustimmung zum Gesetz ließen schon damals einzelne wesentliche Punkte des zur damaligen Zeit vorliegenden Referentenentwurfs Skepsis an der Effektivität des geplanten Gesetzes aufkommen. So zum Beispiel die vorgesehene Entschädigung von bis zu maximal 6.000 Euro und die für jene in der Bundeswehr diskriminierten Soldat*innen geltende Stichtagsregelung bis zum 3. Juli 2000. Von diesem Zeitpunkt an wurde Homosexualität nicht mehr als „Sicherheitsrisiko“ eingestuft und Schwule und Lesben durften offen dienen. Was, wie wir bereits im November schrieben, allerdings auf dem Papier charmanter aussah, als es in der Realität oftmals der Fall gewesen sein dürfte.
Papier ist geduldig, Leid ist beständig
So merkte dann auch schon der Referentenentwurf an, dieses Datum sei „das formelle Ende der Diskriminierung von homosexuellen Soldaten in der Bundeswehr“ gewesen. Das klingt noch heute fast ein wenig süffisant. Inzwischen hat die Bundesregierung einen konkreten Gesetzesentwurf von CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgelegt, der vorsieht, dass alle wehrdienstrechtlichen Verurteilungen von Soldatinnen und Soldaten in beiden deutschen Armeen wegen ihrer „homosexuellen Orientierung“, wegen einvernehmlichen homosexuellen Handlungen oder wegen ihrer geschlechtlicher Identität per Gesetz außer Kraft gesetzt werden sollen. Alle anderen Benachteiligungen der Soldaten sollen per Verwaltungsakt als Unrecht eingestuft werden.
Weiterhin sollen diesem Anfang März im Plenum diskutierten Gesetzesentwurf zufolge die finanziellen Entschädigungen für Betroffene je 3.000 Euro für jede aufgehobene Verurteilung sowie einmalig ebenfalls 3.000 Euro für dienstliche Benachteiligungen betragen. Also jene maximal 6.000 Euro. Wie auch im Plenum traf auch bei der am Montag abgehaltenen öffentlichen Expertenanhörung des Verteidigungsausschusses die Idee der Entschädigung weithin auf Zustimmung, doch gehen den meisten Sachverständigen die Maßnahmen nicht weit genug.
Zu Recht, wie man am Beispiel der Stichtagsregelung ohne jegliche Übergangsfrist festmachen kann, die auch der Rechtswissenschaftler und Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum, Piere Thielbörger, in der Anhörung kritisierte. Er gab zu bedenken, dass eine Verwaltungspraxis, die sich über mehrere Jahrzehnte etabliert hat, kaum von einem Tag auf den anderen ändern werde und sprach sich für einen fünfjährige Übergangsfrist aus. Andere Forderungen sehen eine Frist bis zum 31. Dezember 2009 vor.
Dem Argument ist nicht nur in der Theorie zu folgen, sondern negative Erfahrungen von Betroffenen gehen weit über dieses Datum hinaus und Diskriminierung und die Strukturen, die selbige befördern, verschwinden nicht plötzlich, weil ein Blatt Papier dies nun vorsieht. Papier ist geduldig, die Schwere des Leids des gequälten Geistes erdrückend. Davon abgesehen sind übergangslose Regelungen ohnehin schwierig und das schon bei Themen, die keinen persönlichen Schaden, keine psychischen Belastungen und keine Diskriminierung beinhalten, wie die nicht überraschende Neid-Debatte um die von der SPD durchgeprügelte, völlig willkürliche und bis heute einer soliden Finanzierung ermangelnden Grundrente zeigt.
Im Verteidigungsministerium muss gelernt werden
Darüber hinaus gab es in der Anhörung auch Kritik an der Höhe der Summe der Entschädigungszahlung. Zwar waren sich die meisten Expert*innen einig, dass eine Pauschalisierung durchaus sinnvoll sei, die Höhe jedoch auch als Symbol „dramatisch zu gering“, wie es Sarah Ponti vom LSVD (Lesben- und Schwulenverband Deutschland) nannte. Auch das ist völlig richtig. Angesprochene psychische Belastungen durch Mobbing und fortgesetzte Diskriminierung sind traumatische Erfahrungen. Darüber hinaus bedeuten verweigerte Beförderungen nicht nur weniger Lohn, sondern natürlich geringere Leistungen im Alter, eine verringerte Pension also. Da sind 3.000, beziehungsweise 6.000 Euro, sehr weit weg vom realen finanziellen Schaden (Anastasia Biefang von QueerBW sprach sich unter anderem für eine Nachbeförderung und eine individuelle Entschädigung aus, wenn der nachweisbare Schaden höher als der zustehende Pauschalbetrag ist.) Das in der Anhörung von Philipp-Sebastian Metzger vom Fachbereich Bundeswehrverwaltung der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung vorgebrachte Argument, es handle sich nicht um Schadensersatz und Beförderungen hingen von vielen Variablen ab, ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dennoch ist die im Raum stehende Summe beinahe ärgerlich gering.
Hinzu kommt, dass bereits aus dem Dienst ausgeschiedene Betroffene ihre Ansprüche gegenüber dem ehemaligen Dienstherren einzufordern hätten. Sigmar Fischer von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren, BISS, warnt hier, eben aufgrund der traumatischen Erfahrungen, vor einer hohen Hemmschwelle an und schlägt für jene, die nicht den direkten Weg zum ehemaligen Dienstherrn gehen können und wollen, als erste Anlaufstelle die Deutsche Härtefallstiftung vor. Ein sinnvoller und vor allem emphatischer Vorschlag. Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung spricht dafür, dass man im Ministerium noch immer Probleme damit zu haben scheint, die Schwere und die Belastung dieser Diskriminierungen einordnen zu können (schon die Formulierung „homosexuelle Orientierung“ statt „sexuelle Orientierung“ lässt tief blicken); vielleicht sollten sie einmal ihre eigene Studie zum Thema lesen.
So sehr die Entschädigung und auch auch die Anerkennung der Diskriminierung nach jahrelangem Zögern und viel Ablehnung aus Regierungskreisen und weiten Teilen der Bundeswehr zu begrüßen ist, so unvollständig und unzureichend ist der Gesetzesentwurf. Er wirkt mehr wie ein fahles Symbol, durch das sich nun auf die Schulter geklopft und endlich ein Strich unter alles gemacht werden solle. Nach dem Motto: „Was wollt’s denn noch? Seid’s doch nun belohnt für euer Anderssein!“ Das haben jene, die sich für den Dienst zur Verteidigung unserer Sicherheit entschieden haben, nicht verdient. Und dazu ist das Ding beinahe gratis: Sechs Millionen Euro dürften die Entschädigungen die Steuerzahler*innen kosten. Na Mensch, da könnten doch gar Werte Unionist*innen zufrieden sein.
AS
Hinweis: Bei heute im bundestag findet ihr eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Sitzung.



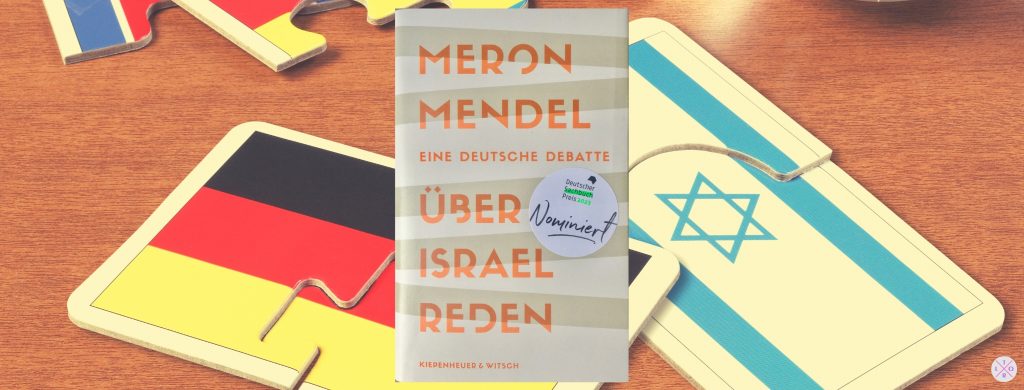
Comments