Vor gut zwei Wochen haben wir euch die in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung Nominierten für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse, der am am 17. März um 16:00 Uhr vergeben wird, vorgestellt. Wir machten ebenso darauf aufmerksam, dass die jeweils fünf nominierten Autor:innen und Übersetzer:innen der Kategorien Belletristik und Übersetzung dem Publikum sich und die Bücher im Literarischen Colloquium Berlin (LCB) vorstellen würden.
Am vergangenen Donnerstag, dem 3. März, war es nun soweit und fünf wohl sehr unterschiedlichen Charaktere stellten ihre fünf sehr verschiedenen Titel vor einem gut gestimmten Publikum vor; moderiert wurde die Veranstaltung von der Literaturwissenschaftlerin Katrin Schumacher vom MDR, selbst einige Jahre Teil der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse, und Jörg Plath, den geneigte hörende Leser:innen aus dem Deutschlandfunk Kultur kennen dürften. Um mit dem Ende zu beginnen: Plath ließ den Abend gegen 21:30 Uhr mit den Worten ausklingen, dass es ein Privileg sei, hier, in dieser entspannten Atmosphäre des LCB Autorinnen und Autoren zuzuhören, während zwei Flugstunden von uns entfernt ein Krieg tobt.
„Ein Kästchen Liebe ist Vaterlandsverrat“
Natürlich fand auch der Rest des zweistündigen Abends im Bewusstsein der kriegerischen Aggression Wladimir Putins gegen die Ukraine und die ukrainische Zivilbevölkerung statt. So passte es, dass den Anfang die in Moskau geborene Autorin Katerina Poladjan machte, die ihr nominiertes Werk Zukunftsmusik (S. Fischer Verlage, Februar 2022) vorstellte, das bezeichnenderweise am 11. März 1985 in einer sowjetischen Kommunlka spielt. Einen Tag zuvor starb das Staatsoberhaupt Konstantin Tschernenko und bereits am 11. März sollte nun ein gewisser Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU werden und den Versuch einer Wende einleiten, den an diesem Tag noch niemand ahnen konnte.
„Eine Kommunalka ist eine Wohnung, die man sich unfreiwillig teilt; so wie in der Sowjetunion die Ideologie.“
Katerina Poladjan mit einer treffenden Analyse gleich zweier Begrifflichkeiten

So auch nicht die Protagonist:innen in diesem Buch, das nur an diesem einen Tag, wenn auch mit einzelnen Rückblenden, spielt, von Poladjan, die im Gespräch mit Katrin Schumacher sagt, es sei damals, ähnlich wie heute, ein ganz spezieller Kippmoment gewesen. Wenn auch heute ein ungleich drastischerer. Poladjan, die 1971 geboren die Sowjetunion 1978 mit ihren Eltern verließ, ergänzt, sie habe sich auch immer mal gefragt, was wäre, wäre sie geblieben? Würde russische Propaganda verfangen? Dieser Eisblock, gegen den die Sowjetunion gefahren sei und die Frage „Was kommt danach?“ anders auf sie wirken?
Fragen, die sich sicherlich auch übertragen in Zukunftsmusik finden, aus dem sie eine Stelle aus dem ersten Drittel vorliest, in der einer der wenigen für die Handlung, in deren Kern vier Frauen aus vier Generationen stehen, wesentlichen Männer im Fokus ist und den die Autorin mit „Ich mag ihn, er ist ein Kauz“ ankündigt. Die kurze Lesung vermittelt eine starke Energie, sofort entsteht ein kleiner Sog, als sie die Sammel- und Katalogisierungsleidenschaft des Mannes beschreibt, inklusive Lakonik und einem verspielten Einschlag.
Ein, trotz des komplexen und nun erst recht aufgeladenen Themas, einladender Titel einer Autorin, die in der ehrlichen Vorstellung des Buches ganz bei sich blieb. Unser Herausgeber liest Zukunftsmusik zur Zeit und ihr dürft gern raten, zu welchem Datum die Besprechung veröffentlicht werden soll.
„Die längste Danksagung, die ich je geschrieben habe“
Es folgt Dietmar Dath, zu dessen Titel Gentzen oder: Betrunken aufräumen. (bei Matthes & Seitz, August 2021) so vieles wohl nicht mehr gesagt werden muss; er dürfte einer großen Öffentlichkeit bekannt sein und hatte, wenn wir so wollen, schon den einen oder andren (virtuellen) Festival- und Buchpreis-Nominierten-Lauf. Doch erlaubt das Gespräch mit Jörg Plath Einblicke zum Buch und den Gedanken dahinter, die zumindest uns so noch nicht bekannt waren und wir gewannen einen Eindruck vom Titel, den weder die verlagsseitige Vorstellung noch bisher von uns wahrgenommene Berichte und Besprechungen vermittelt hatten.
„Der einzige der hier anwesenden Autoren, der noch nicht in Klagenfurt gelesen hat.“ – „Never!“
Dietmar Dath bei der Vorstellung durch Jörg Plath
Dass hier Geschichten von Menschen, ihrem in der Erinnerung Verschwinden und dem bedauerlichen Umgang mit ihnen erzählt werden. Als ein Beispiel nennt er den britischen homosexuellen Informatiker Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg nicht unwesentlich zur Entschlüsselung der Chiffriermaschine Enigma beitrug und anschließend von seiner Regierung, sagen wir, psychisch wie physisch malträtiert wurde. Dath erzählt verschlungen, ein wenig unsortiert, es scheint zu den Protagonist:innen des Buches zu passen. Bis zu einer kruden Marx-Allegorie sind wird fasziniert; anschließend eher konsterniert. Sympathisch, dann aber doch schade.
„Ich wollte Zirkus in diesem Buch“
Von vergessenen Menschen geht es zu einer selbsternannten, proletarischen Prinzessin, nämlich der namenlosen Protagonistin in Heike Geißlers zweitem Roman Die Woche (erscheint am 7. März im Suhrkamp Verlag, am Mittwoch, 9.3., stellt sie es in der Volksbühne in Berlin vor), der laut Klappentext „ein luzider Kommentar auf unsere Gegenwart, ein Plädoyer für Spaß, klugen Protest und das Ringen um Lebendigkeit“ sein soll. Nach dem Gespräch mit Katrin Schumacher und der Lesung lässt sich das gut vorstellen.

Der Gedanke zum Buch sei in der in Leipzig lebenden Autorin infolge all der Montagsdemos, aus denen Pegida, Legida und Co. und eine sich verschlimmernde ideologische Verhärtung hervorgehen sollte, gereift. Denn ihre Protagonistin er- und durchlebt immer wieder Montage (nicht schockiert sein, dass es dennoch mit einem Sonntag losgeht). Dazu gibt es ein ungeborenes Kind, das sich nach außen kommuniziert und einer von vielen Toden liegt bei ihr mit Burn-Out auf der Couch (we feel ya). Hätten wir den Titel nicht ohnehin schon vor geraumer Zeit im Programm markiert, würde dies nun nachgeholt werden.
Schumacher fragt, ob Die Woche denn eine Absage an die Schublade Roman sei, da sich vieles finden ließe. Geißler meint, es sollte halt einiges stattfinden, diverse Konzepte Platz finden, aber immer nur bis dorthin, wo sie dann schließlich das Interesse an der Erkundung einzelner dieser Konzepte verlor. Ob denn die Erzählerin wisse, was sie tue, fragt Schumacher. „Hui, die Frage kam schnell und überraschend“, beginnt sie die für Heiterkeit sorgende Antwort, die zu einem „Ja, ich denke, ja“ führt. Allein schon durch diesen Moment, aber auch die Erläuterungen zu dem Gedanken, wie sich mit Willkürerfahrungen umgehen lassen könne, was das alles mit Francisco de Goya und einer Zirkuskönigin zu tun hat und warum mehr nicht verraten werde, lohnt die Buchvorstellung, die beispielsweise heute Abend im Deutschlandfunk Kultur zu hören sein wird.
„Ich hatte das Gefühl meine türkische Sprache verloren zu haben“
Von einer proletarischen Zirkusprinzessin geht es zu einer Dompteurin von Worten und irgendwie auch des Lebens: Emine Sevgi Özdamar und ihrem Roman Ein von Schatten begrenzter Raum (ebenfalls Suhrkamp, Oktober 2021). Hier soll nicht geflunkert werden, wir schreiben hier schließlich nicht als Romanerzählende, es lässt sich schwer fassen, worum es geht, was wir aus dieser Vorstellung mitnehmen. Ein Leben, autofiktional geprägt, wird erzählt: Verfolgung, Flucht vor der Militärjunta, die sich 1971 in der Türkei an die Macht putschte, die Vertreibung türkischer Griechen; während der Vorstellung des Titels – Emine Sevgi Özdamar beginnt übrigens direkt mit der Lesung ihres faszinierenden, theatralischen aber auch zumindest in dieser Atmosphäre sperrigen Prologs – berichtet sie von einer früheren Freundin, die viel zu jung und vor langer Zeit gestorben sei und die immer sagte: „In diesem Land leben nicht wir, sondern die, die uns töten wollen.“
Ankommen in Europa, Sprache verlieren, finden, Formen der Sprache und Befreiung erkunden, Orte entdecken – ein Paris der Liebe und ein Berlin, dem der Krieg anzusehen ist – Emotionen, sprechen durch ein Baguette und Krähen, alles lebt, alle sind unsere Partner:innen. Viel ist da wohl los, es scheint eine bemerkenswerte Lebensauszugserzählung im Nachkriegseuropa mit allerlei prominenten Gästen zu sein, bewegte sich Emine Sevgi Özdamar doch immer auf dem kreativ-künstlerischen Boulevards des Lebens. Ein Buch, das beeindruckend klingt.
„Alle Schriftsteller haben ein Problem mit der Sprache“
Beeindruckend ist auch das formale und erzählerische Experiment, das der zweite Autor im Nominierten-Reigen, Tomer Gardi, mit seinem Band Eine runde Sache (Literaturverlag Droschl, Juni 2021) wagt und vorlegt. Im ersten Teil des Buches, in dem der Autor als fiktionalisierte Version seiner selbst auftritt, geht es um ein absurdes Krawall-Märchen samt Elfenkönig ohne Elfen, Arche Noah und sprechendem Hund mit einem „Portabel Vagina“-Maulkorb. Diese Zusammenfassung sorgt im Gespräch mit Katrin Schumacher vor allem bei den gesetzteren, etwas lebenserfahrenen Teilen und vor allem Damen des Publikums für große Heiterkeit. Jüngere Millennials und Co. wirkten eher weniger erheitert, teils betreten; Sex und Humor, das geht halt nicht zusammen. Schade eigentlich.

Zumal dieser erste Teil des Buches, den der im Kibbuz Dan in Galiläa geborene Gardi in seinem Deutsch, also einem akzentreichen Deutsch eines Hebräischsprechenden (nicht (!) Jiddisch (!)) verfasste, ein humorvoller und fein durchdachter Rundumschlag mit goldener Pointe ist (ja, wir lesen es). Im zweiten Teil des Buches, der im 19. Jahrhundert spielt, geht es schließlich um den indonesischen Maler Raden Saleh von Java. Den Maler entdeckte Gardi als Indonesien 2015 Gastland der Frankfurter Buchmesse war und er dort ein „schlechtes Buch“ über eine „interessante Figur“ fand. Dieser zweite Teil ist aus dem Hebräischen übersetzt worden von Anne Birkenhauer (übersetzt u. a. auch Zeruya Shalev und Jehuda Amichai).
So begegnen wir in Eine runde Sache also nicht nur zwei unterschiedlichen Geschichten, die, so viel sei verraten, dennoch aufeinander bezogen werden können, sondern auch zwei unterschiedlichen Sprachformen und -klängen. Da ist also noch so ein Thema, das den Abend durchzieht: Das Suchen und Finden von Sprache, Ausdruck und Form. So fällt der Satz Gardis, der diesen Teil überschreibt, sowohl an jenem Abend, als auch in seinem nominierten Buch. Niemand widerspricht.
Stimmung über Funk und Funk
Es lohnt sich also nicht nur, sich die nominierten Bücher alle einmal genauer anzusehen, sondern auch, die drei Autorinnen und zwei Autoren in Bezug auf ihre aktuellen Titel zu entdecken, sie im Dialog wahrzunehmen (der Abend wurde übrigens eröffnet und geschlossen mit dem Bogen, dass hier Bücher und Geschichten mit den Gästen und untereinander in den Dialog kommen, miteinander kommunizieren könnten. Das ist witzig, wir schrieben zur Vorstellung der Titel von einer Lesesymphonie). Das kann zum Beispiel am heutigen Sonntag, 6. März, um 22:03 Uhr in der Sendung Literatur im Deutschlandfunk Kultur, sowie Dienstag, 15. März, 22 Uhr bei MDR Kultur getan werden.
Unsere Besprechung der drei Titel, die wir lesen, folgen allesamt alsbald, jedoch nicht alle vor dem 17. März. Am 8. März werden im LCB übrigens die Nominierten in der Kategorie Übersetzung vorgestellt, auch dies wird später gesendet werden.
Und nein, wir wüssten (noch) nicht, auf welchen Titel wir, unabhängig vom eigenem Wunsch, als Gewinnerbuch tippen würden. Einen Titel allerdings schließen wir aus.
Eure queer-reviewer
PS: Dass nahezu alle der Autor:innen angaben, teils nicht mehr genau zu wissen, was genau in den Büchern steht und wann genau was passiert, beruhigt uns sehr. Ist das doch nach dem Lesen oft nicht so viel anders. Das Zitat auf dem Beitragsbild stammt aus Eine runde Sache und ist ein tolles Lebensmotto.
PPS: Die die verschiedenen Abschnitte einleitenden Zitate stammen von den jeweiligen Autor:innen.
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitstzeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun. Vielen Dank!


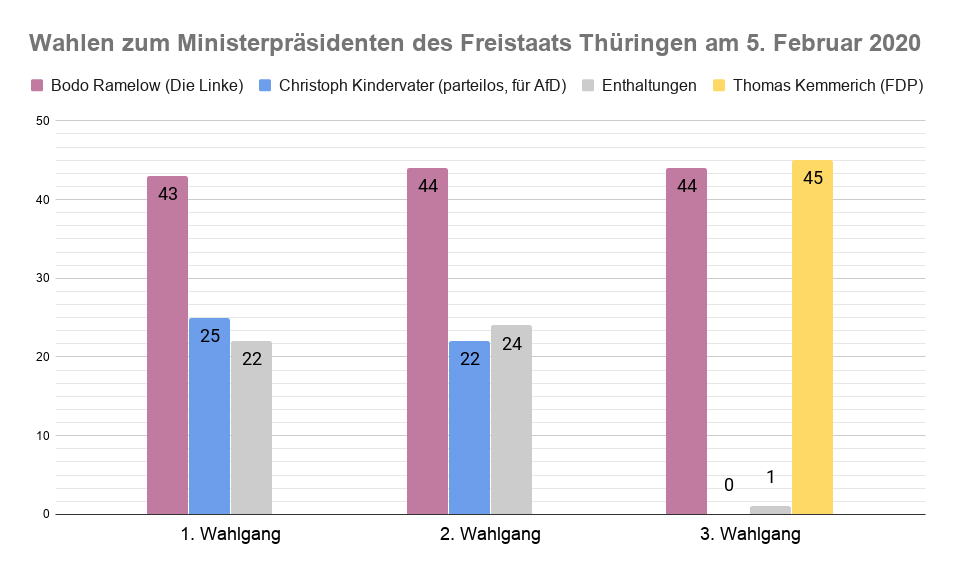

Comments