Bryan Washington erweist sich in „Lot“ als ein großartiger Erzähler und erklärt uns in den „Geschichten einer Nachbarschaft“ das sozial prekäre Houston und die Magie der Verbundenheit.
Von Nora Eckert
„Ich brauchte eine Weile, um zu kapieren, dass wir nur die sind, die wir uns erlauben zu sein.“
Bryan Washington
Eigentlich sollte man beim Lesen von Bryan Washingtons Erzählungen, die, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, im Mai im Kein & Aber Verlag erschienen sind, einen Stadtplan von Houston ausgebreitet neben sich haben, denn von Geschichte zu Geschichte lernen wir sehr viel über die Ränder dieser Stadt, fernab der Touristenstrecken und Hochglanz-Kulissen, die vor allem soziale Randzonen sind. Manchmal sei es besser, sich in „Houstons Ritzen“ zu verkriechen und sich dort einzurichten. Das jedenfalls tun etliche in Washingtons Erzählungen.
Da haben wir es beispielsweise mit einer sich auflösenden Familie zu tun, bei der am Ende die als Restaurantbetreiberin erfolglose Mutter und der schwule Sohn übrigbleiben. Doch das Leben geht immer weiter, auch wenn Menschen in den Tod oder nur ins Unbekannte oder ins Vergessen verschwinden. Wir tauchen ein in die Welt der Drogen-Dealer und der Stricher und erfahren, dass Rassismus keine Einbahnstraße ist.
Es sind Familien- und Nachbarschaftsgeschichten von autofiktionalem Charakter. Klar ist, hier schreibt der Autor über seine Stadt und über Menschen, die er darin kennt und die in dieser Stadt für gewöhnlich nicht auf der Seite der Gewinner leben. Unklar bleibt lediglich, mit welchem biografischen Anteil der Autor sich selbst einbringt. Aber das ist eigentlich unwichtig. Es geht in den Erzählungen immer um menschliche Bindungen und so auch um Verbundenheit, aber zugleich um deren Unmöglichkeit, weil die Fliehkräfte am Ende stärker sind und prekäre soziale Verhältnisse Erosionen im Menschlichen bewirken. Und so ist wohl das den Erzählungen vorangestellte Motto zu verstehen: „Und wie kam ich / zurück? Wie kam irgendwer von uns / zurück, als wir nach / Schönheit suchten?“
Der Zufall wollte es, dass ich anschließend einen Band mit Reportagen und Feuilletons von Joan Didion aus den sechziger Jahren las. Einer der Texte ist überschrieben mit „Vom Nachhausekommen“ und handelt vom belanglosen Leben während eines Besuchs bei den Eltern: „Dass ich in dieser Belanglosigkeit gefangen bin, wird mir nie deutlicher vor Augen geführt als zu Hause.“ Das ist bei Bryan Washington offenbar nicht anders. Bestimmte Erfahrungen scheinen sich über soziale Milieus hinweg zu wiederholen. „Am Ende waren es nur noch Ma und ich, und wenn ich nicht gerade durch Midtown kreuzte, hinten das Geschirr spülte oder draußen in Montrose Jungs fickte, saß ich auf dem einen Ende des Sofas, Ma ließ sich auf das andere nieder, und ihre Knie streiften meine Schenkel, während sie über den Fernsehlärm einschlief.“ Häusliche Idyllen, geboren aus lauter Banalität und auch Sprachlosigkeit – hier wie dort. Dennoch, das Zuhause ist immer auch ein Erinnerungsort, angefüllt mit lauter Familien-Anekdoten: „Ohne Ma ist das Haus ein Album. Ein Greatest-Hits-Sampler.“
Apropos Sprache – natürlich ist sie das Kennzeichen jeder schriftstellerischen Arbeit, ihr unverwechselbarer Ausweis, nämlich wie etwas erzählt wird, also die Frage des Stils. Washingtons Sprache ist von einer kaum zu überbietenden Direktheit. Sie ist absolut schnörkellos, kommt fast ganz ohne Adjektive aus, ist immer knapp, lakonisch, aber in ihrer Deutlichkeit ebenso eindringlich. Genau das ist mir schon bei der Lektüre seinen Debüt-Romans Dinge, an die wir nicht glauben aufgefallen. Washington schreibe, wie Menschen heute sprechen oder genauer, wie sie heute twittern, hieß es in meiner Rezension. „Seine Sprache ist immer ganz schnell […] sie ist eine Art Rap, nur viel schöner, weil der Autor mehr als nur eine Tonlage beherrscht.“ Festzustellen war nun, dass dies Washington schon in seinen frühen Erzählungen gelingt.
Das Tragische tritt bei ihm so unvermittelt und leise auf, dass man es glatt übersehen könnte, es packt einen mit einer gewissen Verzögerung, sozusagen hinterrücks. Gleichwohl passt hier Joan Didions Einsicht: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.“ Denn hinter Washingtons scheinbarer Gleichgültigkeit, stecken eine unverhohlene Lebensgier und Sehnsucht nach was auch immer – es darf auch die oben zitierte Schönheit sein oder Sex, der nie beschrieben, nur konstatiert wird wie das Geschirrspülen oder Müllwegbringen. So gesehen ist all die sprachliche Lässigkeit nur eine brüchige Oberfläche, etwas absichtlich Gespieltes.
Der Stadtteil Alief ist einer der Schauplätze, ein Viertel, das mit illegalen Einwanderern vollgestopft sei. Alief sei das übelste Viertel, so der Autor. „In den Jahren, die wir hier wohnen, haben wir Kokain-Kriege miterlebt, diverse Neuordnungen der Territorien und die gewohnten Revierkämpfe zwischen den Schulen, Schießereien […].“ Aber dann wieder eine Bemerkung wie diese: „Weißt du, es ist komisch, aber seit ich in Houston bin, habe ich keine Sterne mehr gesehen.“ Genau hier sind die Familiengeschichten angesiedelt, die eine zentrale Rolle spielen. Ma führt ein nicht allzu gutgehendes Restaurant, der Vater geht dauernd fremd und verschwindet irgendwann völlig von der Bildfläche, der ältere Bruder ist homophob und kommt später bei der Armee durch einen Unfall ums Leben. Einmal sagt er, „das Einzige, was schlimmer wäre als ein Junkie-Vater, sei ein schwuler Sohn“. Die ältere Schwester heiratet schließlich einen Whiteboy und fühlt sich damit als etwas Besseres, als eine Aufsteigerin.
Eines Tages kommt die Cousine der Mutter zu Besuch aus Jamaika. Gloria ist etwas Besonderes, man solle sie behandeln, „als wäre sie aus Porzellan“ – eben der „gewohnte Familienzirkus“. Gloria hatte studiert, war dann Mutter geworden und danach eine Prostituierte – „eine von den Frauen, die ihre Beine für Saftsäcke (wieder die Worte meiner Mutter) breit machten“ – „und so suchte ich in ihren Augen nach dem, das sie dazu machte. Aber alles, was ich sah, war eine ganz normale Lady“.
In „South Congress“ erleben wir einen Dealer und seinen Fahrer bei ihrer Arbeit. Die Stadt sei ein Netz von unterschiedlichen Süchten, überall geht was anderes. So verwandelt sich der Stadtplan zu einem Drogenatlas, der davon erzählt, an welcher Ecke, welche Drogen gingen. „Die Sucht diskriminiert niemanden, sagt Avery. Sie verschlingt jeden Dreckskerl. Deshalb diskriminieren auch wir nicht, sagt er, wir sind Chancengleichheits-Pharmazeuten.“ Das Ende ist schockierend und darf hier nicht verraten werden.
In einer der längeren Erzählungen, betitelt mit „Waugh“, geht es um den Aufstieg und Fall eines Strichers. Rod ist so eine Art Chef einer Gruppe junger Sexarbeiter, aber kein Zuhälter. Seine Geschichte steht im Zentrum und sie ist eine des Abstiegs und des Verschwindens. Er gibt die Ratschläge, wie man beispielsweise Stammkunden heranzieht: „Schaff feste Muster. Die werden zur Gewohnheit. Und Gewohnheiten bedeuten sichere Einkünfte und sorgen dafür, dass wir die Rechnungen bezahlen können.“ Und über die Freier: „Er rieb ihnen die Köpfe und kraulte ihnen die Brust. Lächelte über ihre Witze und tat all das, weil er wusste, dass er sie nie wiedersehen würde.“ Doch dann geschieht etwas, was Rod aus der Bahn wirft, aber er verweigert die Hilfe, die ihm einer der Jungs anbietet. „Wenn er Rod ausfindig machte, beobachtete er ihn. Er ließ sich Zeit. Rod sah nicht schlechter aus. Er war Teil der Szenerie geworden.“ Irgendwann ist er ganz aus dieser Szenerie verschwunden, und so endet die Suche im Nichts. Wie schon gesagt, das Leben geht immer weiter, in anderen Besetzungen, in wechselnden Kulissen und mit den immergleichen Sehnsüchten nach Verbundenheit. Bei Washington kommt das ohne ein Gramm Sentimentalität aus, weil er weiß, dass das Leben eine offene Rechnung ist und es an jeder Kreuzung (auch in Houston) mindestens drei Alternativen gibt.

PS: In meiner Besprechung von Bryan Washingtons Roman für literaturkritik.de kam das N-Wort in einem Zitat vor. Die Redaktion empfahl, es nicht wörtlich zu zitieren, sondern so N*. In den Erzählungen verwendet Bryan Washington wohl aus Gründen der Authentizität ständig das Wort „Nigga“. Er selbst ist Schwarz. Was er über das Wort denkt, verrät er an keiner Stelle, aber er verwendet es wie das ganze sonstige Leben ungefiltert und gegen alle Regeln von political correctness. Im Nachhinein fand ich es seltsam, dass ein Original-Zitat nicht original zitiert werden darf. Bryan Washington ist weder ein Rassist noch dürfte er gleichgültig gegenüber dem Rassismus sein, aber ich schätze, nach allem, was ich von ihm gelesen habe, dass es sein Realismus ist, der ihm sagt, Rassismus schaffe ich nicht dadurch ab, dass ich ein Wort nicht verwende. Auch wenn er es so nicht sagt, aber seine Geschichten erzählen es immer wieder: Rassismus ist strukturell und vor allem ein ökonomisches Problem von Ausbeutung und Ausgrenzung. Nennt man es vielleicht dialektisch, die Wirklichkeit zu zitieren, weil so die Bruchstellen deutlicher sichtbar werden?
Nora Eckert ist Publizistin und Vorstand bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society
Bryan Washington: Lot. Geschichten einer Nachbarschaft; Aus dem Amerikanischen Englisch von Werner Löcher-Lawrence; Mai 2022; 240 Seiten; Hardcover, gebunden mit Schutzumschlag; ISBN: 978-3-0369-5869-9; Kein & Aber Verlag; 23,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!


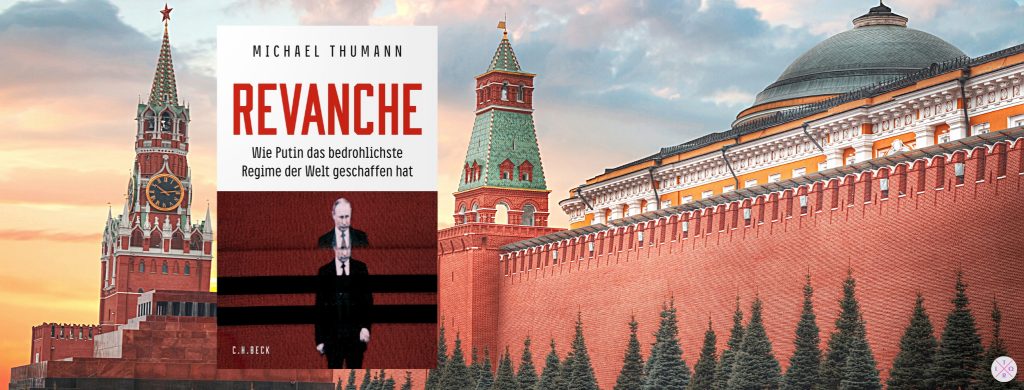
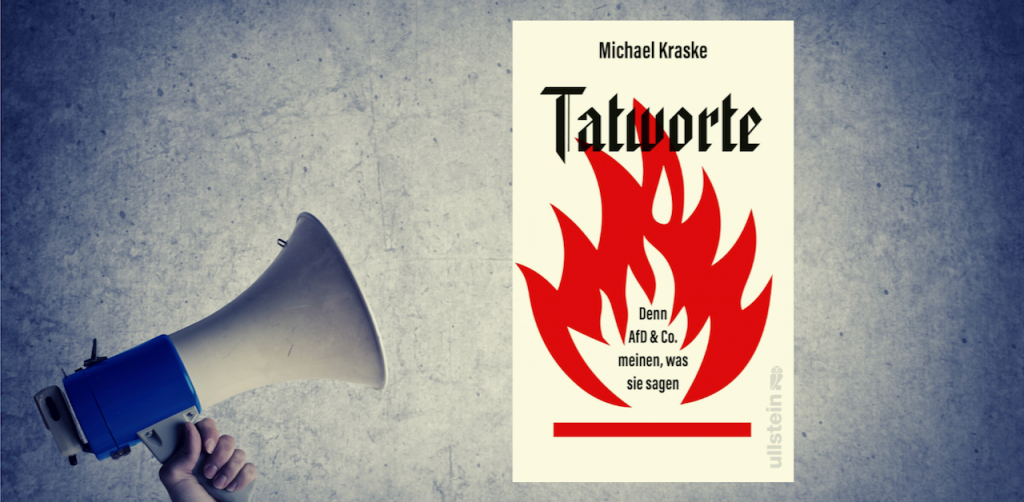
Comments