Ann Petrys Roman The Narrows von 1953, auf Deutsch im Verlag Nagel & Kimche erschienen, ist eine späte literarische Entdeckung und zeigt, wie Liebe in rassistischen Zeiten unterschiedlich buchstabiert wird. Die afroamerikanische Autorin schaut tief in die Menschen hinein. Was sie findet, ist faszinierend, berührend, erschreckend und abstoßend – und alles zugleich.
Von Nora Eckert
Es ist Nacht und dazu dichter Nebel. Eine Frau wird verfolgt und trifft auf einen jungen Mann. Genauer gesagt, trifft sie auf seine Stimme, da sie sich in der Dunkelheit kaum sehen können, die ihr wiederum zu verstehen gibt: Bei mir bist du sicher. Sie weiß nicht, dass die Stimme einem Schwarzen gehört. Später wird sie ihm erklären: „Ich musste versuchen, das zusammenzukriegen, diese Stimme, die Sicherheit bedeutete, und dass du farbig bist, aber das ging nicht.“ Da sind beide bereits ineinander verliebt. Der junge Mann heißt Link Williams und wohnt ganz in der Nähe in dem von Schwarzen bewohnten Viertel The Narrows. Seinem „Ersatzvater“ Bill Hod, dem das Lokal „The Last Chance“ gehört, erzählt er von seinem Verliebtsein und tat es mit einem „Rebellenschrei“, dass „der gellende Ton die Gläser auf den Regalen zum Klirren brachte“. Wieder auf der Straße, betrachtet Link die Leuchtreklame – „grell orangerotes Neon, einen Block weit zu sehen. Und lachte. Weil er wieder einmal das Gefühl hatte, die Welt erobern zu können. The Last Chance.“
Eigentlich ist es nur eine Liebesgeschichte. Aber was heißt schon „nur“ in durch und durch rassistischen Zeiten, wenn er Schwarz und sie weiß und dazu noch verheiratet und steinreich ist? Wie soll das zusammen gehen? Mit Happy End gar? Undenkbar. Was aber bleibt für einen Roman übrig, wenn das Scheitern vorhersehbar ist? Ein abgekartetes Spiel als Drama mit der Lust des Publikums am Drama? Und indem die Hauptdarstellerin Liebe den Rassismus als Hauptdarsteller an die Seite bekommt, wechselt das Drama unwillkürlich in die Tragödie.
Am Ende jedoch sind es eher andere Dinge, bei denen wir unerwartet hängenbleiben und die berühren, weil nämlich Ann Petry die Romanfiguren regelrecht aufblättert, und dabei lauter verborgene Wahrheiten und Widersprüche zutage fördert – sozusagen die Tiefenschichten, die Ablagerungen, die der Rassismus in den Menschen hinterlässt. Es geht um all die Selbsttäuschungen und Verdrängungen im Leben, aber ebenso sehr um Sehnsüchte, Begehren, Verletzlichkeit und auch um die Frage von Schuld. Bei Petry sind die Figuren immer ganz nahe. Wie sie das in Worte bringt, mit welcher sprachlichen Intensität, und wie unvorhersehbar schließlich alles wird, macht aus dem Roman große Literatur, ein Meisterwerk. An dem in der deutschen Übersetzung Pieke Biermann einen nicht zu überschätzenden Anteil hat, denn sie erschafft sozusagen noch einmal, eben in einer anderen Sprache, diesen gewaltigen Raum der sich kreuzenden und kollidierenden Schicksalslinien.
Was aber ist ein Meisterwerk? Was zeichnet es aus? Die Sprache hatte ich gerade genannt, sie ist ein sicheres Zeichen, dann etwas wie Tiefe, auch Menschlichkeit. Petry gelingt mit The Narrows nichts weniger als ein Gesellschaftspanorama aus der Zeit um 1950, zusammengesetzt aus lauter Psychogrammen, und angesiedelt in einer Stadt namens Monmouth mit dem glitzernd blauen Fluss Wye, breit und tief und trügerisch – zwei Autostunden entfernt von New York.
Die Namen von Stadt und Fluss fand die Autorin übrigens in Shakespeares Historiendrama Heinrich V. Wie schon dort sind nun die beiden Namen auch im Roman auf der Weltkarte als Parabel erneut eingetragen und stehen für einen anderen Ort und einen anderen Fluss, deren wirkliche Namen entbehrlich sind, weil sie hier wie dort die gleiche Beschaffenheit aufweisen und die Romanwelt, wie im Vexierbild aller Parabeln, für eine zwar unbenannte, aber sichtbare Realität steht.
In jener Nacht an der Kaimauer kommen Link und Camilo, so heißt die junge Frau mit dem hübschen Gesicht und den „blassgelben, weichen, seidigen Haaren“, ins Gespräch. Sie wollte das Kai besichtigen erklärt sie, weil sie darüber in der Zeitung gelesen hatte mit diesen wunderbaren Fotos dazu. Sie landen in einer Bar und dort wird ihm klar, dass er eine weiße Frau an seiner Seite hat und nicht eine hellhäutige Schwarze, wie er zuerst glaubte. Und sogleich fällt ihm ein Schulerlebnis ein: Der braune Junge und seine weiße blauäugige Mutter. Sie erschien zum Elternsprechtag in der Schule, die durch sie in einen Schockzustand geriet. Und wieder ist es eine Art Schock. Link spürt ihre weiße Überheblichkeit anfangs, den herablassenden Tonfall, aber auch ihre Angst. „Die glaubt, ich will sie vergewaltigen. Steht mir doch zu […] ich bin ja farbig, und es ist festgeschrieben, dass farbige Männer einzig und allein dafür leben, weiße Frauen zu vergewaltigen […].“ So geht es Link durch den Kopf. Es wird dennoch eine Liebesgeschichte. Ihre „lachende Arglosigkeit“ kann er ebenso wenig vergessen wie den Gesichtsausdruck als eine Mischung aus herausfordernd, erwartungsvoll und einladend.
Camilo schlägt vor, nach New York zu fahren, um sich dort zu vergnügen. Die Ausflüge werden zur ständigen Einrichtung. In einem der Hotels richtet Camilo ein Art Liebesnest ein, aber Link kommt damit immer weniger klar. Alles ist von ihr in Perfektion inszeniert, alles zahlt die Dame, und er ist der „Plantagenbulle“, der Gigolo. Trotzdem träumt er anfangs von Heirat, weil er dachte, „das zwischen ihnen, das sei die Einmal-im-Leben-Liebe“. Doch die Situation in New York wird für ihn unerträglich, und er kommt sich wie ein Spielzeug vor: „Seine Aversion gegen alles, das Mädchen, das Auto, das Hotel, alles, sich selbst eingeschlossen, war so heftig, dass er den Portier ansah und dachte: Der gehört in den Zoo samt diesen dunkelroten Mantelschößen […] und diesem Affengesicht mit dem eingerasteten käuflichen Grinsen […].“
Dann plötzlich geschieht das Unerwartete, ein Riss geht mit einmal durch die Liebe und der zerstörerische Rassismus lässt die Geschichte ins Tragische kippen, verwandelt Zärtlichkeit in Hass. Camilo wird für Link zur Heimsuchung, sie schimpft ihn „schwarzer Bastard“, und er begreift, dass sie für ihn ein Beitrag zum „Bildungsprozess“ in Sachen „Race“ sei. „Jetzt kann ich sagen, ich habe den Leistungskurs in einer höheren Bildungsanstalt absolviert“, den „Graduiertenkurs zum Thema Race“. Wie das vor sich geht, muss man selbst lesen, und es greift mächtig an.
Ich habe behauptet, es seien am Ende andere Dinge, an denen wir hängenbleiben würden. Es ist vor allem Ann Petrys grandiose Menschendarstellung. Sie nimmt sich Zeit, um die Menschen sehr genau zu beobachten. Das Licht fällt immer aus sehr unterschiedlichen Richtungen auf sie und kommt ebenso oft aus der Vergangenheit. Rückblenden und auch Überblendungen der Zeiten sind wie die inneren Monologe bei ihr ein wesentliches Stilmittel. Die Personen im Roman werden dadurch vielschichtig, wie Menschen eben sind. Faszinierend ist der gleichzeitig weite und ganz nahe Blick. Faszinierend auch Petrys Begabung, innere Bewegungen präzise zu beschreiben, als schauten wir den Menschen förmlich beim Denken zu.
Da wäre zum Beispiel Abbie Crunch, die in der Dumble Street ein Backsteinhaus von „aristokratischem Flair“ besitzt. Zusammen mit ihrem Mann, dem Major, hatte sie einst Link adoptiert, als er noch ein Kind war. Ihren Ehrgeiz übertrug sie auf ihn, dem die Hautfarbe nicht zum Hindernis in seinem Leben werden sollte, die durch Disziplin freilich nicht verschwindet. Er sollte eine bessere Zukunft haben und die schulischen Erfolge lassen nicht lange auf sich warten. Sein Geschichtsstudium in Dartmouth schloss er mit Bravour ab. Abbie achtet stets auf den guten Ruf und darauf, was andere sagen. Ohne dass ihr das in dem Moment klar war, lieferte sie jedoch mit ihrem Handeln den Kippmoment in der Geschichte und lässt die getrennten Welten kollidieren. Zur Selbsterkenntnis bedurfte es allerdings erst der Katastrophe, aber nun war ihr gleichgültig geworden, was andere dachten oder sagten. „Dann dachte sie gereizt: Wir allen waren es, auf die eine oder andere Weise. Wir hatten alle die Finger im Spiel, wir haben alle mit Gewalt auf diese Menschen reagiert, auf Link und auf diese Frau, weil er farbig war und sie weiß.“
Berührend auch die Geschichte von Malcolm und Mamie Powther, die die obere Etage in Abbies Haus gemietet haben. Er ist Butler in einem Millionärshaushalt, aus dem Camilo stammt, und lebt in der ständigen Angst, Mamie, dieser Inbegriff von weiblicher Sinnlichkeit, könnte eines Tages nicht mehr da sein. Er begehrt sie geradezu animalisch und ständig plagt ihn Eifersucht. Irgendwann hatte er seinen Stolz verloren. Aber Mamie war nun mal sein Lebenssinn. Die Ereignisse um Link und Camilo verändern auch ihn. Nie hätte er vorher gedacht, der fest an die Trennlinie in Sachen Race glaubte, dass er seine Mamie einmal mit Camilo vergleichen würde, um zu lernen, dass verheiratete Frauen mit Affären nicht verkommen sind. „Sie werden jünger, strahlen Glück aus, und andere Leute fühlen und spüren das, und das macht sie schöner.“
Und dann wäre noch Bill Hod zu erwähnen und wie er zum Ersatzvater für Link wurde. Als Abbies Mann starb, an dessen Tod sie mit Schuld trug, ist sie darüber so verwirrt, dass sie Link völlig vergisst. „Sie hatte ihn aus ihrem Leben ausgesperrt, von sich abgetrennt.“ In dieser Verlorenheit findet ihn Bill Hod. Ausgehungert wie Link war, fragt er nach Essen und Bill reicht ihm die Hand. „Die Hand war warm und fest. Link antwortete auf die Berührung der Hand, auf ihre Wärme, auf ihre Festigkeit, eine Hand, die zupacken, sich bewegen konnte und sich nach Leben anfühlte, mit einer Frage, die er gar nicht stellen wollte: ‚Mister, haben Sie irgendwas zu essen für mich?‘“ Bill ist nicht weniger streng als Abbie, nur anders – eben umweglos brutal.
Der moralische Kern des Romans ist, wenn man so will, die Einsicht, es gebe im falschen Leben kein richtiges – aber immerhin Versuche, aus dem falschen Leben auszubrechen. Link Williams ist so einer, der das versucht, um herauszufinden, wo genau die Grenze verläuft. Das beginnt harmlos schon auf den ersten Seiten des Romans, als der achtjährige Link vom Kai aus in den Fluss springt, um so mal eben das Schwimmen zu lernen. Das Abenteuer endet mit ein paar Ohrfeigen, die ihm Bill Hod verabreichte, damit er sich die Grenze ja merke. Irgendwie ging es dann immer weiter mit Lektionen – bis zur letzten, tödlichen.
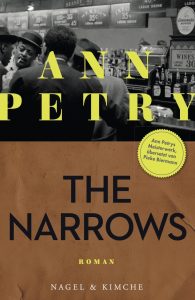
Nora Eckert ist Publizistin, im Vorstand beim Bundesverband Trans* e.V. und bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society
Ann Petry: The Narrows; Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Pieke Biermann; März 2022; 576 Seiten; Hardcover mit Schutzumschlag; ISBN 978-3-7556-0016-9; Nagel & Kimche Verlag; 28,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!
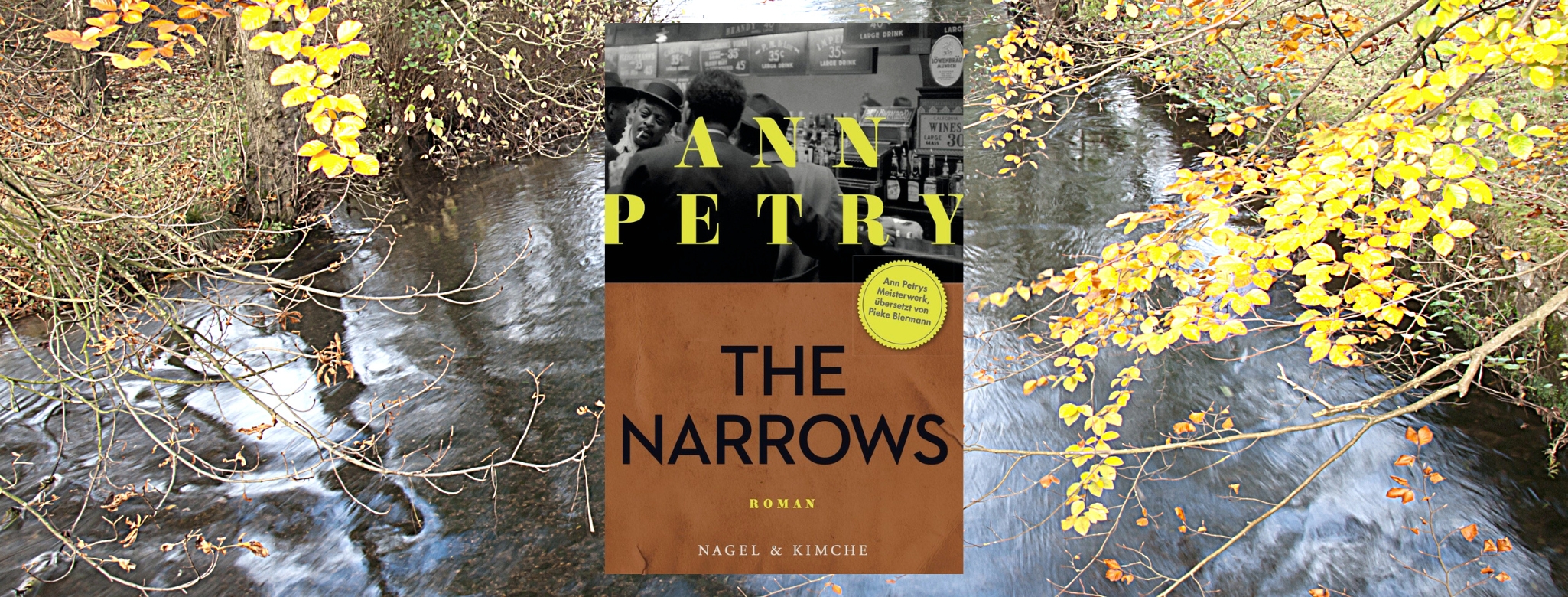



Comments