Wiedergelesen: Pier Paolo Pasolinis Roman Petrolio
Von Nora Eckert
Es sollte sein Hauptwerk werden – das Porträt einer korrupten und infamen Gesellschaft mit einer zentralen Gestalt namens Carlo, der eine doppelte Identität führt und abwechselnd und zugleich männlich und weiblich ist. Carlo Valletti heißt dieser „Gespaltene“, der zum sanftmütigen Carlo Polis und zum diabolischen Carlo Thetis wird. Geblieben ist es ein Fragment von weit über 600 Seiten mit projektierten 2000 Seiten. Auch als Fragment gehört es zu den literarischen Solitären, zu denen ich Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, Hans Henny Jahnns „Fluss ohne Ufer“, Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, James Joyce‘ „Ulysses“, William Gaddis‘ „Die Fälschung der Welt“ und noch einige mehr zähle. Was sie eint, das ist eine überbordende Sprache in Verbindung mit einer nachgerade manischen Detailbesessenheit und etwas, das wir panoramatisches Denken nennen könnten, das alles mit allem verknüpft. Gleichviel was da verhandelt wird, es geht immer ums Ganze.
Und obschon die literarische Beschreibung der Welt Realismus beansprucht, bleibt ein erratischer Rest, der bei Pasolini leicht ins Surreale kippt, ebenso wie das Paradoxon der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Weshalb sich im Fall von Pasolinis Romanentwurf die italienische Gegenwart der 1960er Jahre zugleich antikisch liest mit einem Argonauten-Auftritt darin und noch mehr solcher Raum und Zeit überblendenden Szenarien. Pasolini nennt die Argonauten-Passage eine „mythische Reise in den Orient“ und notiert dazu: „alles auf griechisch schreiben (mit einer knappen Übersetzung in Telegrammstil, doch erschöpfend in den Titeln der Abschnitte)“. Solcherlei Experimentierlust wie überhaupt das Ausufernde (einmal nennt Pasolini Lawrence Sterne als Vorbild für seine literarische Abschweifung) nimmt die Desorientierung des Lesers bewusst in Kauf. „Mein Roman folgt keiner ‚Bratspießanordnung‘, sondern dem ‚Gewimmel‘“. Der Leser solle es als ein Divertimento nehmen, was sogleich an David Foster Wallace „Infinite Jest“ denken lässt (den ich übrigens auch den literarischen Ausnahmewerken zurechne).
Als „Petrolio“ 1992 in Italien posthum erschien, löste das Romanfragment wenig überraschend eine kontroverse Diskussion aus. Pasolini, der 1975 ermordet wurde, vermochte noch immer zu skandalisieren und zu polarisieren. Vielleicht auch deshalb, weil seine kritischen Befunde über den Zustand der italienischen Gesellschaft in ihren Prognosen zutreffend waren. Mit seiner radikalen Gesellschaftsanalyse traf er dort, wo es weh tut, bei der Wahrheit. Und sie war und ist eine der unheilvollen Verstrickung von Politik, Ökonomie und Religion. Sie ist der Ausgangspunkt für seine Kulturkritik und die Basis seiner Befunde zu Fragen der gesellschaftlichen Mentalität.
Hinzu kommt bei Pasolini ein ungehemmter Umgang mit der Sexualität, deren sexistischer Charakter offen zutage liegt und bei aller Deutlichkeit vor allem als schwuler Sex gleichsam magisch aufgeladen erscheint. Sexuelle Handlungen von einer nicht zu leugnenden Brutalität verwandeln sich bei ihm förmlich in rituelle Inszenierungen, als ob das Begehren liturgischen Gesetzen folge, eingehüllt von einer romantisierten Natur unter einem mondbeschienenen Nachthimmel und angefüllt mit aromatischen Düften. Es geht dabei um Carlos „geheimes Leben“. Oder anders gesagt: „Das Ziel alles dessen ist nichts anderes als die Lust der Sinne, des Körpers, genauer und unmißverständlicher ausgedrückt, des Schwanzes.“ Da kommt der Hinweis auf „Die Philosophie im Boudoir“ des Marquis de Sade wenig überraschend, der es vermochte, über sadistische Erfahrungen „mit Ironie, ohne Sehnsucht“ sich zu erinnern.
Zwei Jahre später, also 1994, folgte nach der italienischen Erstausgabe Moshe Kahns bewunderungswürdige deutsche Übersetzung, die ich damals las. Pasolini war da schon fast zwanzig Jahre tot und so kam diese Veröffentlichung wie eine Überraschung, verbunden mit der Erinnerung an eine Zeit, in der er noch lebte und für uns den Status einer schwulen Ikone innehatte. Wir sahen im Kino seine Filme, die in ihrer Radikalität oft eine Zumutung bedeuteten, und die uns gerade deshalb faszinierten – und auch in ihrer Disparatheit zwischen „Teorema“, „Medea“ (mit einer stummen Maria Callas), „Decameron“ und „Die 120 Tage von Sodom“.
Die Kapitel heißen bei ihm Anmerkungen, 133 gibt es davon. Manche ganz knapp, nur aus ein paar Stichworten bestehend, andere wieder sehr umfangreich, die bereits literarisch ausgearbeitet erscheinen. Die meisten Anmerkungen lesen sich wie Regieanweisungen mit mal mehr, mal weniger ausführlichen Settings und oft umfangreichen Besetzungslisten. In einem Brief an den befreundeten Schriftsteller Alberto Moravia spricht er selbst von einer Sprache des Essays, die „eher an die Sprache von Exposés oder Drehbüchern erinner[e] als an die Sprache von klassischen Romanen“. Dennoch sollte da ein gewaltiges Epos entstehen, das er an anderer Stelle auch so nennt.
Pasolini beweist eine Charakterisierungskunst von hohen Graden. Es bereitet ihm große Lust, die Menschen in „Petrolio“ so genau wie pointiert zu beschreiben. Die wenigsten von ihnen dürften wirklich erfunden sein, sondern wohl nahezu vollständig der gesellschaftlichen Wirklichkeit entstammen. Er erweist sich hier als ein Kenner der sozialen Milieus. Das geht einher mit einer physiognomischen Präzision, die wir vor allem von Proust kennen. Da heißt es beispielsweise über eine Person, die als Angehöriger der „kulturell vorurteilslosesten Elite“ beschrieben wird: Es erlaube ihr, „außer Zeitungen und Zeitschriften praktisch nichts zu lesen […] nach Cambridge hatte er außer ein paar Monographien über Eisenstein und Hitchcock eigentlich überhaupt kein Buch mehr gelesen“ – höchstens ein paar Seiten bei Lévi-Strauss und Frantz Fanon. Man ist schließlich modern.
Ein besonderes Lektüre-Vergnügen bereiteten die Szenen im Salon der Signora F., einer kunstfördernden Signora, die wie eine zweite Madame Verdurin Intellektuelle um sich schart. Der Autor beschreibt sie so: kugelrund, zwergenhaft, Haare kaum mehr als ein Büschel, „ein blonder Haarbesen“ zum Pferdeschwanz gebunden, „ihre Augen waren groß, affektiv und ein bißchen irre“, Kinderfettigkeit, kleine Nase, noch kleinerer Mund, aus Neapel stammend und Bewohnerin einer Villa, von der es heißt: „Ihr Mann, der sich mit seinem Tod endlich nützlich gemacht hatte, hatte sie ihr hinterlassen.“ Pasolini selbst sprach von einer gewissen Ähnlichkeit mit der Gouverneurin Julia Michailowna aus Dostojewskis „Dämonen“. Auch das kommt hin. Empfänge in den 60er Jahren habe, so Pasolinis Beobachtung, Leute versammelt „mit einem auf die Lippen geleimten Lächeln, mit dem Glas oder mit einem Törtchen in der Hand; und vor allem […] in jenen gedankenlosen Mangel an Mitgefühl“.
An anderer Stelle beschreibt Pasolini akribisch Konzernstrukturen und ihre politischen Verflechtungen. Drei Buchstaben stehen für einen „Topos der Macht“ – ENI. Die Rede ist von einem Imperium, indem es eine Schlüsselfigur als „Schattenwesen“ gebe, denn jener Aldo Troya geht jeder Publizität aus dem Weg. Er hatte „auch nicht die Schwächen der Ehrgeizigen: sein Leben, sein Aussehen, sein Verhalten waren grau oder besser gesagt: asketisch.“ Die 60er sind auch die Zeit, einer bescheidenen Digitalisierung der Arbeitswelt: „Avantgarde-Techniken“ wie „Computer Letters“, „Mailing Lists“ und „Direct Marketing“ setzen sich durch. Und nebenbei erinnert uns Pasolini, dass junge Frauen damals mit Maxi-Mänteln herumliefen.
Auf 37 Seiten wird unter der Überschrift „Die Wiese an der Via Casilina“ geschildert, wie Carlo nacheinander Sex mit zwanzig jungen Männern hat – sein „Verhalten wurde unverzüglich zu einer gewissen Nachahmung der hastigen Leistung einer Nutte, die zugeben darf, daß sie das, was sie macht, außer für Geld auch zum Vergnügen macht“. Der Unterschied besteht darin, dass Carlo für die Dienste bezahlt, die er den Männern gewährt.
Carlo wird gleich zu Beginn als dieser Gespaltene vorgestellt. Als Engel und Teufel führen sie einen Streit darüber, wem der Körper gehöre. Carlo Polis meint, es sei der Körper „eines Guten, eines Folgsamen“, worauf Carlo Thetis antwortet, „schön, aber die Last, die in ihm ist, gehört mir“. Mit der Gespaltenheit geht es auch um die abgelehnte und angenommene Sexualität und schließlich darum, Macht zu begehren, wobei Pasolini die Beteiligung an der Macht eine besondere italienische Wissenschaft nennt. Doch will der Autor am Ende mehr zeigen, als einen gespaltenen Charakter, auch wenn der äußere Eindruck das vermittle. „Im Gegenteil, dieses Epos ist ein Epos über die Besessenheit von der Identität und zugleich über ihre Zersplitterung.“ Wer dieses Romanfragment zur Lektüre wählt, sollte keine Angst vor Besessenheit haben. Ein Tag vor seinem gewaltsamen Tod gab Pasolini ein Interview, in dem es um den politischen Zustand Italiens ging und mit einer Macht als Erziehungssystem. Der letzte Satz in dem nicht zu Ende geführten Interview lautet: „Dennoch bestehe ich weiterhin darauf zu sagen, dass wir alle in Gefahr sind.“
PS: Ein persönlicher Nachtrag: Ich kam Ende 1973 als vermeintlich schwuler junger Mann nach West-Berlin, verkehrte in der HAW, der „Homosexuellen Aktion Westberlin“, als deren Erbe wir das Schwule Museum und das Schwuz kennen, erfreute mich des damals schon recht üppigen Angebots an schwulem Nachtleben und war bald Teil eines Freundeskreises. Einige von ihnen sind bis heute meine Freunde geblieben. Das Jahr 1975, in dem Pasolini ermordet wurde, war für mich ein bedeutsames Jahr, eigentlich das wichtigste in meinem Leben. Ich entdeckte mein trans*Sein und versuchte, ein neues Leben zu planen. Denn mindestens das enthielt die Erkenntnis, trans* zu sein – ein komplett neues Leben. Im April 1976 begann ich im Chez Romy Haag an der Eintrittskasse zu arbeiten und damit startete ich, was wir heute Transition nennen. Das Schwulsein war passé, ein Irrtum und das Frausein die große Herausforderung.
Natürlich erinnere ich mich an den Schock, den die Nachricht von Pasolinis Tod auslöste, und irritiert war ich, weil ich zugleich das Gefühl hatte, eine Nachricht wie aus einer anderen Welt im Fernsehen zu hören und in den Zeitungen zu lesen. War ich nicht gerade dabei, mich von meiner Männlichkeit zu verabschieden, und zwar so, als ob es auch einen Tod gebe, bei dem man am Leben bleibt oder überhaupt erst anfängt zu leben? Auf jeden Fall nahm ich den Namen Pasolini wahr, als sei er für mich Teil von etwas Vergangenem. Den Schock gab es trotzdem über die brutale Zurichtung durch seinen Mörder – oder waren es mehrere? Wenn ich es richtig sehe, ist das nie wirklich aufgeklärt worden.
Als ich 1981 aus einer Laune heraus anfing, Italienisch zu lernen, hatte das nichts mit Pasolini zu tun, wohl aber mit dem Land, das mich in seiner Widersprüchlichkeit, seiner so ganz anderen Mentalität magisch anzog. Ich liebte den italienischen Film, Fellini ebenso wie Visconti und auch den Neorealismo eines Rossellini. Was sie zeigten, das hob sich wohltuend von meiner eigenen Welt ab und war zugleich anziehend. Und dann gab es dieses Dolce Vita, das ich als angehende Transfrau in den späten Siebzigern für mich als Lebensmodus entdeckte. Oft blieb es ein Traum, denn inzwischen war ich in einer Animierbar am Stuttgarter Platz gelandet. Und trotzdem war die Schäbigkeit und im Grunde Spießigkeit dieser aus den Sechzigern übriggebliebenen Bars gar nicht weit entfernt von dem, was ich in bestimmten Filmen wahrnahm – all dies Grelle, Laute, Unmittelbare. Und schließlich waren es die Frauen, die mir imponierten und die Anna Magnani, Giulietta Masina, Sophia Loren, Gina Lollobrigida hießen. Das waren alles gute Gründe Italienisch zu lernen – und Pasolini jetzt wieder zu lesen.
Nora Eckert ist Publizistin und Ausführender Vorstand bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society

In der Woche vom 4. bis zum 8. Juli veranstaltet das Italienische Kulturinstitut Berlin diverse Pasolini-Abende – unter anderem wird am 5. Juli der Band Nach meinem Tod zu veröffentlichen. Gedichte (Suhrkamp) vorgestellt und am 6. Juli ist Moshe Kahn zum Gespräch über „Pasolini als Romanerzähler“ mit Maike Albath verabredet. Hier findet ihr alle Veranstaltungen.
Pier Paolo Pasolini: Petrolio; Aus dem Italienischen von Moshe Kahn; 720 Seiten; ISBN: 978-3-8031-2742-6; Verlag Klaus Wagenbach; 19,00 €; auch als eBook
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun. Vielen Dank!
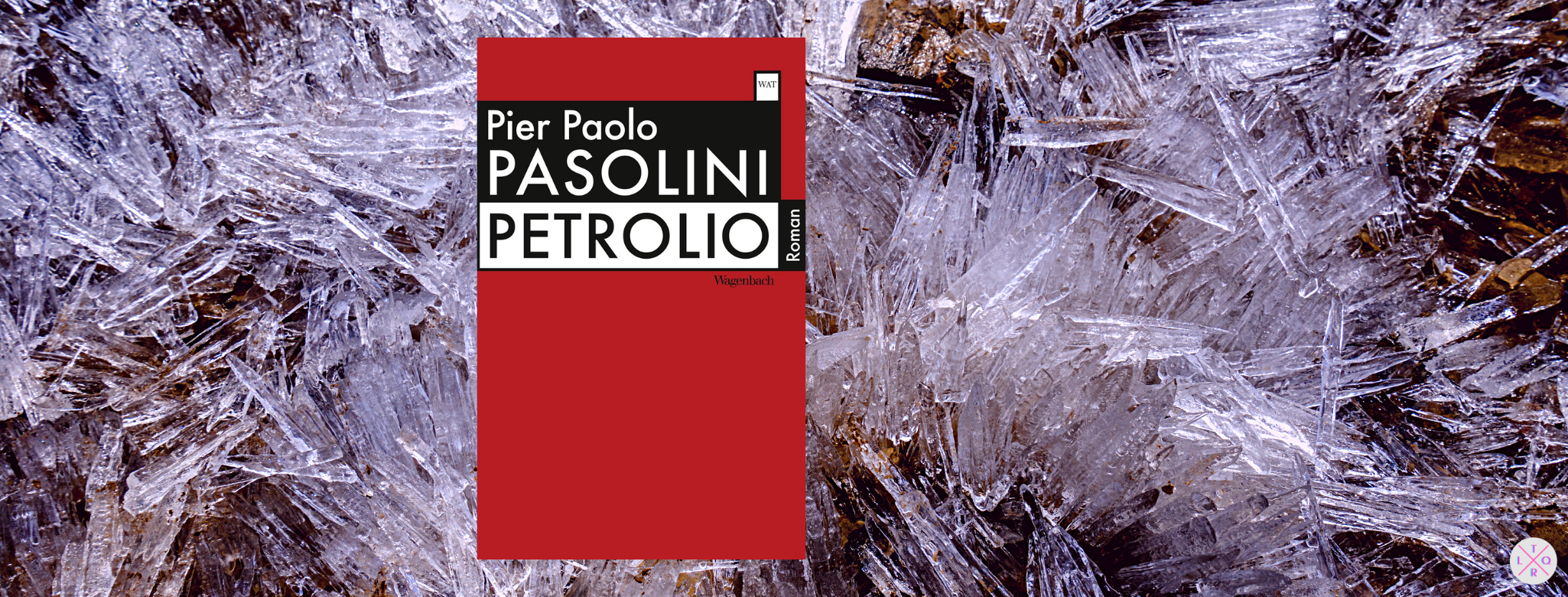



Comments