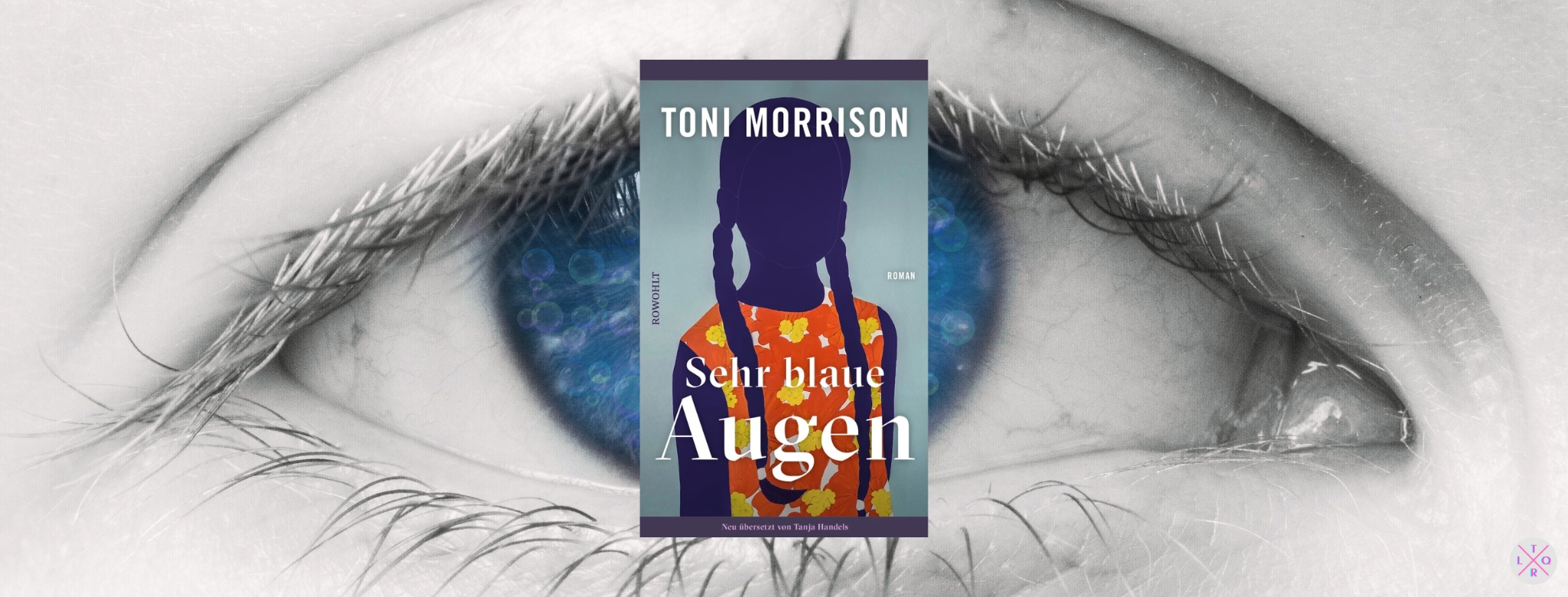Toni Morrison betrat 1970 mit ihrem Roman The Bluest Eye die literarische Bühne und setzte damit einen Meilenstein in der US-amerikanischen Literatur. Mit Sehr blaue Augen liegt nun eine deutsche Neuübersetzung vor, die Morrisons erzählerische Kraft erneut zum Ereignis macht, was unzweifelhaft auch ein Verdienst der Übersetzerin Tanja Handels ist.
Von Nora Eckert
Der Rowohlt Verlag, in dem das Werk der Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison auf Deutsch erschienen ist, hat sich vorgenommen, das Werk nach und nach in Neuübersetzungen und Überarbeitungen für neue und kommende Generationen zu erhalten und zugänglich zu machen. Das ist umso verdienstvoller, als Morrisons Romane nichts von ihrer Aktualität verloren haben und schon gar nichts von ihrer Sprachmächtigkeit, sie bleiben literarisch einzigartig. Der Rassismus lebt nach wie vor in den Köpfen der Menschen und übt Tag für Tag seine zerstörerische Gewalt aus. Von genau dieser Gewalt erzählt Morrison und sie tut dies stets aus der Perspektive der vom Rassismus betroffenen Menschen.
Im Fall von Pecola Breedlove, einem Schwarzen Mädchen aus ärmsten Verhältnissen, ging es der Autorin jedoch nicht um den Widerstand gegen eine stigmatisierende Fremdwahrnehmung, sondern um „die weitaus tragischeren und lähmenderen Folgen, die es hat, wenn wir die Ablehnung als berechtigt, als etwas Selbstverständliches akzeptieren“, wie sie uns in einem später verfassten Vorwort wissen lässt.
Wir sprechen hier von Internalisierung, von der Verinnerlichung eines negativen Fremdbildes, die bei Pecola in Selbsthass mündet oder genauer gesagt in den Wahn, blaue Augen besitzen zu wollen, die für sie der einzig gültige Ausweis von Schönheit sei mit Shirley Temple als ihrem Idol. „Die ganze Welt war sich einig, dass eine Puppe mit blauen Augen, blonden Haaren und rosa Haut genau das war, was jedes kleine Mädchen für sich erträumte.“ Die Geschichte endet damit, dass Pecola sich einem Wunderheiler anvertraut und danach von dem Glauben besessen ist, sie schaue die Welt nunmehr durch die blauesten Augen an, die ein Mensch nur haben könne.
Doch bis zu diesem Ende haben wir noch von vielen weiteren Erschütterungen erfahren. In dem gerade zitierten Vorwort bringt Morrison allerdings auch ihre Enttäuschung zum Ausdruck, und zwar darüber, dass sich die Lesenden durch Geschichten wie der von den Breedloves und von Pecola berühren, nicht aber wirklich bewegen lassen. Wobei zu fragen wäre, wie diese Bewegung aussehen würde und wie sie erkennbar wäre. Sicherlich durch das Verschwinden eines strukturellen Rassismus in der Gesellschaft und der alltäglichen rassistischen Vorurteile, die ihn noch in winzigsten Dosierungen fortsetzen. Aber für den Weg vom kritischen Bewusstsein hin zu einer rassismusfreien Welt reicht die Zeitspanne eines Menschenlebens offenkundig nicht aus.
Und was hätte Literatur je anderes vermocht, als das Denken in Gang zu setzen? Das immerhin wäre eine Chance. Morrison wird das wohl so gesehen haben, wobei sie sich mit ihrem Romanerstling – und absichtsvoll – erzählerisch unkonventioneller Mittel bedient. Sie bricht die Erzählung in Fragmente auf, indem sie beispielsweise in Rückblenden die Eltern Pauline und Cholly Breedlove, mit ihren Lebensgeschichten porträtiert und dabei beschreibt, wie die Familie in einer ständigen Abwärtsbewegung irgendwann auf der Straße sitzt, was im Leben am meisten zu fürchten sei – auf der Straße sitzen.
Gleich, ob wir mit Pecola in die Schule gehen und eine neue Schülerin kennenlernen, ob wir zusammen mit ihr die drei Sexarbeiterinnen Poland, China und Marie besuchen (bezeichnenderweise ein Ort, an dem es in einem guten Sinne am menschlichsten zugeht) oder ob uns die Autorin die Lebensgeschichte dieses karibischen Mannes und Wunderheilers berichtet, den alle Soaphead Church nennen und den Pecola um die blauen Augen bittet, immer tun sich Brüche und mit ihnen Abgründe auf. Manches darin ist einfach auch urkomisch, grotesk. Und manchmal leuchtet für einen Moment sogar etwas wie Liebe auf. Und Menschlichkeit ist dem Roman schon deshalb nicht fremd, weil Morrison eine Begabung besitzt, tief in Menschen hineinschauen zu können.
Ganz am Anfang gibt es einen kurzen Absatz in einfacher Sprache, der von einer Familienidylle handelt und ein grün und weiß gestrichenes Haus beschreibt, wo zwei Kinder, eine Katze und ein Hund zusammen mit Mutter und Vater wie aus dem Bilderbuch leben. Man lächelt und spielt, der Hund macht Wauwau, eine nette Freundin kommt hinzu. Das perfekte Klischee einer heilen Welt. Die Autorin reißt die Sätze auseinander und verteilt sie auf die folgenden Kapitel als Überschriften. Doch die Kapitel weigern sich beharrlich, die Idylle fortzuschreiben. Was sie mitteilen ist vielmehr das genaue Gegenteil, mit dem das Klischee Lügen gestraft wird.
Das ist einer der „Kunstgriffe“, die sich die Autorin mit ihrem Erstling erlaubt, um den Denkapparat von uns Leser*innen in Gang zu setzen. Sie wird in ihren folgenden Werken noch viele andere finden. Aber nichts davon ist leichte Lektüre. Dafür sind andere zuständig. Ihre Romane sind nichts für das Nebenbei-Lesen. Genau das macht ihre Qualität aus, man kann sich nur ganz auf sie einlassen oder gar nicht, aber niemals nur halb. Deshalb sei hier das Resümee zitiert, zu dem der Kritiker Haskel Frankel 1970 in seiner Besprechung des Romans für die New York Times kam:
„Nach Abwägung aller Stärken und Schwächen entschied ich mich dennoch für The Bluest Eye. Es gibt viele Romanautoren, die bereit sind, die Hässlichkeit der Welt als hässlich zu bezeichnen. Der Schriftsteller, der die Schönheit und die Hoffnung unter der Oberfläche enthüllen kann, ist ein Schriftsteller, den man suchen und ermutigen sollte.“
Toni Morrison hatte es gewiss als Ermutigung verstanden.
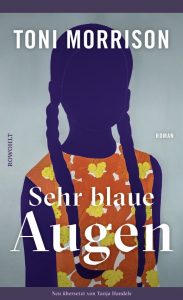
Nora Eckert ist Publizistin, im Vorstand beim Bundesverbandes Trans* e.V. und bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society
Toni Morrison: Sehr blaue Augen; September 2023; Aus dem Englischen von Tanja Handels, mit einem Nachwort von Alice Hasters; Hardcover, gebunden mit Schutzumschlag; 272 Seiten; ISBN 978-3-498-00367-8; Rowohlt Verlag; 24,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!