Deutsche Bürokratie trifft auf das um Elemente der Korruption angereicherte Pendant in der Ukraine. Dmitrij Kapitelman erzählt von seinen Erfahrungen mit ukrainischen Behörden und Gesundheitseinrichtungen als er zuerst Eine Formalie in Kiew erledigt und sich anschließend um die Behandlung seines erkrankten Vaters kümmern muss. Eine Geschichte von Migration, Identität und so mancher Wahrheit.
Was ist eine Apostille? Vermutlich haben viele Deutsche diesen Begriff noch nie gehört. Der Noch-Ukrainer Dmitrij Kapitelman, Jahrgang 1986, aber will Deutscher werden und wird daher mit der Apostille konfrontiert. In seinem autobiografisch geprägten Buch Eine Formalie in Kiew, das jüngst bei Hanser Berlin erschien, erläutert er daher, wie er versucht, eine ebensolche in der Hauptstadt seines Geburtslandes zu erledigen.
Er stößt dabei auf beklemmende Bürokratie, gepaart mit einem dezent korrupten Staatswesen und später einem Gesundheitswesen, in dem freundschaftliche oder gar familiäre Verbundenheit – in der Ukraine vor allem bekannt als: Geld – viel nutzt. Kaum ist die eigentliche Aufgabe nämlich erledigt und die Apostille eingeholt, muss Kapitelman seinen kranken Vater durch die Untiefen des ukrainischen Gesundheitswesens navigieren und seine Erkenntnisse mit der Apostille direkt wieder einsetzen. Es entspinnt sich eine Geschichte, die sich mit den Eigenheiten der ukrainischen Kultur und des deutschen Gemüts auseinandersetzt und zugleich die Zusammenführung einer nun in Sachsen heimischen Familie am Dnjepr einleitet.
Was passt: Kapitelman startet mit fulminantem Humor in seine Geschichte. Er erläutert sehr anschaulich Aufgabe und Ausgangslage. Frau Kunze, die Bearbeiterin seines Einbürgerunsantrags, wird herrlich sächsisch zitiert und der Hintergrund zur Immigration der jüdischen Familie Kapitelman nach Deutschland soll später noch wichtig werden, sogar die vielen Katzen, die Kapitelmans Mutter Vera in ihrem vom Sohn in Liebe verachteten „Katzastan“ hegt und pflegt. Das gesamte Familienkonstrukt mit kränklichem Vater, der seinen Zenit wohl überschritten haben dürfte und der katzenverliebten Mutter, die zwar liebevoll ist, aber ähnlich gut im Muttersein, wie so manche Mutter aus dem jüngsten Polizeiruf 110, dürfte außerdem die eine oder andere Eltern-Kind-Beziehung gut widerspiegeln.
Die Story ist nicht nur dank der vielen anschaulichen Metaphern und des ironischen Wortwitzes überaus kurzweilig und in sich schlüssig, auch wenn es eigentlich eher zwei Geschichten sind, die auf den ersten Blick zufällig aneinander anschließen. Sich hindurchziehende Symboliken und Verhaltensweisen – vor allem die auch in der Ukraine omnipräsenten Katzen, das Nichtbetreten von Gullydeckeln oder die Standfestigkeit von Bäumen – verhelfen der Geschichte dennoch über beide Teile hinweg zu inhaltlicher und erzählerischer Kohärenz.
So manche Eigenheit der Ukrainer wird hier gekonnt in Szene gesetzt und macht trotz einiger Schattenseiten ein großes, teils von der Geschichte oder von Invasoren arg geschundenes Volk, sympathisch. Gleichzeitig kann man aus der bequemen Perspektive eines Deutschen bei manch einer kulturellen Eigenart der Ukrainer froh sein, sich nicht durch den Bürokratie- und Korruptionsdschungel von Kiew schlagen zu müssen. Eine Formalie in Kiew beschreibt somit auf herrliche Art und Weise, vor welchen Problemen Einbürgerungswillige hierzulande oftmals stehen, welche Kulturkonflikte sie manchmal erleben müssen und wie sehr sie vielleicht dennoch die deutsche Kultur bereits internalisiert haben, sobald sie zurück in ihr Geburtsland kehren.
Was passt nicht so: Manche Teile der Geschichte ziehen sich ein wenig, beispielsweise direkt nach der Ankunft in Kiew. Dmitrij (vermutlich ist das der Name des Ich-Protagonisten) verließ die Ukraine als Kind und bekam damals von der Bestechungskultur nicht so viel mit. Da musste er nun in kurzer Zeit „hineinwachsen“. Das braucht seine Zeit, ist auch halbwegs nachvollziehbar, aber zieht sich dennoch ein wenig. Ähnlich läuft es ein zweites Mal als es darum geht, dass sein Vater behandelt werden muss.
Bei alldem wird oft nicht ganz klar, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die der Autor hier erzählt. Der Begriff „Roman“ taucht anders als bei der von uns jüngst besprochenen Autofiktion Das achte Kind nirgends auf, aber wir wissen eben auch nicht, ob und welche Teile Fiktion sind. In einem Interview gibt er diese Entscheidung an die Marketingabteilung des Verlags ab, was bei der Entschiedenheit, mit der der literarische Dmitrij vorgeht, erstaunlich mutlos oder – noch schlimmer – indifferent anmutet.
Fazit: Eine Formalie in Kiew erzählt mit viel Charme, Ironie und Wortwitz eine Geschichte von Migration, Integration und Sehnsucht. Autor Dmitrij Kapitelman zeigt den vermutlich primär deutschen Leserinnen und Lesern einen Ausschnitt des alltäglichen Lebens in der Ukraine und besonders der Widrigkeiten, mit denen die Menschen in dem noch heute durch Krieg geplagten Land kämpfen. Er macht auf Umstände aufmerksam, die nur wenige erdulden wollen dürften. Im Prinzip ist Eine Formalie in Kiew daher ironischerweise eine Hommage an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auch wenn sie mit eben den Hindernissen aufmacht, die diese beiden Prinzipien mit sich bringen. Dennoch sind sie für ihn so erstrebenswert, dass er die bürokratischen Hemmnisse der Ukraine auf sich nimmt und eine Reise in die vergangene Gegenwart unternimmt.
Trotz so einiger Längen – viele tragen am Ende allerdings zur Eindrücklichkeit des Büchleins bei – verpackt Dmitrij Kapitelman seine Geschichte recht charmant und ansprechend. Dabei lernt er sich, sein Ursprungsland, seine neue Heimat und auch seine Familie ganz neu kennen und das ist sehr viel wert. Und man lernt mit den Worten von Frau Kunze, dass eine Apostille „die behördliche Beschdädiung einör behördlichen Beschdädigung von dar nächsthöhern‘n Behörde“ ist.
HMS
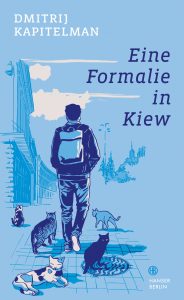
Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew; 1. Auflage, Januar 2021; 176 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag; ISBN: 978-3-446-26937-8; Hanser Berlin; 20,00 €; auch als E-Book erhältlich, 15,99 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitstzeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!



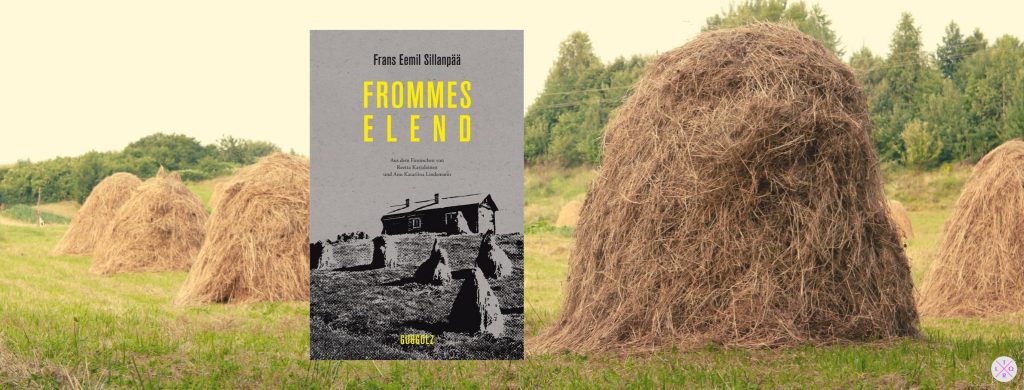
Comments