Foto: © Nic Jordan, CONBOOK Medien GmbH
Mit dem Begriff „Vagabund“ verbindet man intuitiv das Bild eines ungepflegten Landstreichers, der verwegen seinen Weg durch das beschwerliche Leben sucht und trickreich meistert. Als Vagabundin bezeichnet sich auch Nic Jordan, die in ihrem im September erschienenen Buch aWay – Wie ich nichts mehr zu verlieren hatte und per Anhalter von London nach Australien reiste das schildert, was der Untertitel schon so wenig prägnant beschreibt.
Dabei passt der Begriff der Vagabundin recht gut auf die Protagonistin. Unzufrieden mit ihrem Leben in London beschließt sie eines hässlichen Tages mit britischem Wetter, von nun an sechs Monate zu sparen und ans andere Ende der Welt zu trampen. Über Kontinentaleuropa – in München besucht sie ihre Mutter in ihrer alten Heimat, in Polen ihren Vater, mit dem sie sich nach dem Selbstmord ihres Bruders zerstritten hatte – und Skandinavien, durch Sibirien, China und Südostasien steuert sie ihr Ziel an der australischen Ostküste an. Dabei geht allerhand schief, aber vieles läuft auch sehr gut, so wie das auf solchen Abenteuern eben läuft.
Eine überaus anschauliche Reisechronik
aWay ist die Chronik einer etwas anderen Reise und erzählt aus Nics sehr subjektiver Perspektive, wie sie ihre Situationen erlebt hat. Das macht sie sehr eindrücklich und anschaulich. Viele würden einfach schreiben, dass sie sich in einer Situation wohl oder unwohl gefühlt haben, dass es schlechtes Wetter war und ihnen das aufs Gemüt geschlagen hätte oder so ähnlich. Nic Jordan geht aber weiter. Sie beschreibt ihre Eindrücke und als Leserin oder Leser sitzt mensch vor dem Buch und hat ein genaues Bild vor Augen. Von dem malerischen See in Norwegen, an dem sie durchnässt das Alleinsein genoss. Oder von einer verschwitzten und dehydrierten Mittzwanzigern, die sich in der gleißenden Sonne von Kambodscha zur nächsten Tankstelle quält, um Benzin für das leere Auto zu holen.

Zu dieser Anschaulichkeit trägt bei, dass sie relativ häufig Dinge und Gegenstände vermenschlicht und ihnen Aktivitäten zuschreibt. Der Tequila, der sich nach einer Party in Stockholm befindet, zwang sie beispielsweise „auf die Toilette zu rennen, um die Reste zu erbrechen“ (S. 121/122) oder als sie in Indonesien ist, schreibt sie: „Ein zerbrechendes Glas weckte mich“ (S. 383). Das ist ein anderer, eindringlicherer Erzählstil, als wenn sie sich wegen des Tequilas übergeben müsste oder sie wegen eines zerbrechenden Glases wach geworden wäre. Sie nutzt dieses Stilmittel allerdings relativ häufig, was irgendwann auch zur Abnutzung führt und dann nach meinem Geschmack eher stört.
Eine lange Reise hat eine lange Lücke
Das ist aber nicht alles, was hier störend ist. Fangen wir mit der Struktur an: Auf mehr als 400 Seiten schreibt Nic über ihre Reise um die halbe Welt. Das ist schon relativ stattlich und hätte eigentlich Stoff für mindestens zwei Bücher geliefert – wahrscheinlich mehr, wenn man bedenkt, wie viele Eindrücke eine solch lange Reise gern hinterlässt. Die ersten 200 Seiten spielen sich aber dann vollständig in Europa ab. Nicht falsch verstehen, Europa ist ein absolut bereisenswerter Kontinent und es gibt in unserer unmittelbaren Umgebung mehr als genug zu sehen. Aber anfangs beschreibt sie überaus detailliert, welche Besuche sie noch machen muss – Freunde, Familie, mit denen sie sich teils vor längerer Zeit verkracht hat.
Das ist auch sehr wichtig, um ein Gefühl für sie und ihren Hintergrund zu bekommen. Auch ihr Scheitern auf der Huskyfarm in Lappland scheint sie sehr geprägt zu haben und generell scheint Skandinavien einen nachhaltigen Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben. Das geht aber auf Kosten der restlichen Abschnitte. Durch Russland und Sibirien und anschließend auch durch China hetzt sie gefühlt hindurch (durch Russland nimmt sie tatsächlich großteils die Transsibirische Eisenbahn, was das ein wenig erklärt), so wie sie schließlich auch Australien leider nur ein mageres Kapitel am Ende widmet.

Rein geografisch gesehen werden somit gefühlt zwei Drittel der Reise mit wenigen Worten – in der Regel recht markig und dezent genervt abgefrühstückt, was sehr schade ist. Klar, bei einem Reisebericht hebt man im Nachhinein die Teile hervor, die einen am meisten beeindruckt haben, aber als Leser freut man sich ob des Titels und der im Umschlag eingezeichneten Route eigentlich auf die Erfahrungen mit Kälte in Sibirien, Kommunismus in China und Kängurus in Down Under. Im Prinzip könnte man also einen Teil I (Europa) und einen Teil II (Südostasien) machen und dort jeweils ein Kapitel zu Russland, China und Australien anfügen. aWay tut dieser inhaltliche Bruch nur bedingt gut.
Ein bisschen Vorbereitung schadet nicht…
Nun kommen wir zum Inhalt: Wie bereits oben beschrieben, Nic Jordan legt mit aWay ein überaus anschaulich geschriebenes Buch vor, aber allzu oft muss man sich bei der Lektüre einfach nur an den Kopf fassen. Voller Stolz und Inbrunst schreibt sie zu Beginn, dass sie in der Vorbereitung keinerlei Zeit damit verschwendete, „‘die schönsten Strände in Thailand‘ oder ‚Was isst man in China?‘ zu googlen“ (S. 18). Stattdessen würde sie sich um Organisatorisches kümmern, Visa, Krankenversicherung, die eine oder andere Fähre.

Das ist ohne Frage wichtig, denn ohne all diese Punkte steht man gerne da, wie Nic an besagtem See in Norwegen: klatschnass und von der Realität eingeholt. Zumindest ein ganz klein wenig landeskundliche Informationen über die Länder zu sammeln, die sie bereisen will, ist aber in sechs Monaten Vorbereitung durchaus machbar. Sich in Peking zu wundern, dass es dort Smog gebe und zwar jeden Tag, das hätte selbst meine kaum gereiste Mutter nicht getan und die tagesschau ist auch keine neue Erfindung. Oder dass es in Russland ein kyrillisches Alphabet gibt. Herrje, es gibt Sachen, für die braucht man nicht einmal Vorbereitung, sondern hin und wieder einen Blick in die Zeitung oder ein gutes Buch (wir stellen ja regelmäßig das eine oder andere vor).
…und verhindert Geschichtsvergessenheit und Ignoranz
Aber dass Nic vollkommen geschichtsvergessen zu sein scheint, wird gleich zu Beginn ihrer Reise klar. Sie liegt am Strand von Dünkirchen/Dunkerque (ab Seite 40) und scheint das Leben vollauf zu genießen, vollends unwissend über das Drama, das sich 1944 an selber Stelle abgespielt hat. Britische Soldaten waren an diesem Strand gefangen und dem Tode geweiht, da die deutschen Truppen anrückten und sie einkreisten. Nic zieht es vor, in dieser Umgebung ihr Leben zu genießen, ohne einen Funken Demut oder ähnliches. Jedenfalls geht aus ihrem Text an keiner Stelle hervor, dass sie um die Vergangenheit des Ortes wüsste oder falls doch, sich darum scherte.
Das aber passt auch zu der Szene in Moskau (S. 239/240), in der sie mit amerikanischen Lehrern – also vermutlich gebildeten Leuten, aber dennoch nicht der Spitze der Bildungselite – Weihnachten feiert und sich unter „diesen Menschen“, die „sich aufgrund ihrer akademischen Leistungen für etwas Besseres“ (ebd.) hielten, findet. Ignoranz ist halt keine Einbahnstraße.

Klar, man kann nicht alles wissen – vermutlich war sie nicht über die Geschichte von Dünkirchen/Dunkerque informiert – aber ihr oder spätestens jemandem im Lektorat hätte auffallen müssen, dass diese Passage ähnlich heikel ist wie fröhliche Selfies am Berliner Holocaustmahnmal. Allerdings scheint das Lektorat ohnehin etwas schludrig gewesen zu sein, denn das Buch enthält immer noch recht viele Grammatik- und Rechtschreibfehler. Viele davon stören zwar nur bedingt, aber „Pearl Harbour“ (man schreibt es ohne U) ist doch etwas ärgerlich.
Ein wohl anstrengende Person
Auch Nic wäre aber wohl öfter gut damit beraten, etwas aufmerksamer zu sein und ihre Energie richtig zu verwenden. Klar, ihre Art zu reisen, den Mut, das Abenteuer, auf das sie sich einlässt, das verdient größten Respekt – zumal als Frau, denn als Frau zu trampen ist vermutlich eine noch weit größere Herausforderung und Gefahr denn als Mann. Und es ist vollauf nachvollziehbar, wenn sie schildert, warum es hart war, in einer Situation so lange an der Straße zu stehen und dann skeptisch war, wenn Autos für sie anhielten. Davon lebt das Buch zu einem großen Stück.
Etwas anderes ist es aber, wenn bei jedem/r zweiten, der oder die sie mitnimmt, erst einmal eine halbe Seite darüber zu lesen ist, warum das eine schlechte Idee war, dass sie bestimmt jetzt entführt und gefoltert wird und anschließend jämmerlich krepiert. Bestimmt, es gibt solche tragischen Fälle und es ist gut, wenn Nic über ihre Gefühle und Gedanken schreibt. Aber wenn ihr solche „Sorgen“ bei gefühlt jedem zweiten Auto kommen, dann fängt es an, irgendwann zu nerven. Zumal sie am Ende nie wirklich verschleppt wurde, sondern tendenziell bei finnischen oder kambodschanischen Familien landete, die sie wuschen, bekochten, beherbergten und/oder noch 200 Kilometer weit in die nächste Stadt fuhren.
Reflexion sollte auch den eigenen Charakter umfassen
Wo Nic Jordan schließlich wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zeigt, ist bei ihr selbst. Alle paar Seiten kommt ein kurzer Abschnitt, in dem sie reflektiert. Zurückdenkt an die Vergangenheit – oft auch an Situationen vor der Reise – und evaluiert, wo sie jetzt steht. Das wiederum ist einerseits sehr nett, denn es zeigt, dass ihr Weg tatsächlich auf sie wirkt und sie merkt, dass sie oder ihre Einstellung gegenüber Leuten, Gesellschaften oder Ländern sich ändert.

Andererseits sind es an vielen Stellen auch Allgemeinplätze. Das Ende ist wie gesagt sehr gehetzt: Innerhalb von etwa 15 Seiten „hastet“ sie im Buch durch Australien, eine Strecke, wie von Deutschland bis nach Hammerfest. Und genauso muss am Ende noch viel selbstreflexives Blabla hineingequetscht werden, das einer Sammlung von Kalendersprüchen entspringen könnte. Das ist kein Fazit, sondern ein Prokrustesbett. Hier wird am Ende noch irgendwas hineingezwängt, weil es muss ja. Ein unlöbliches Ende, wie ich finde. Fast so unlöblich, wie sie ihren schwulen Reiseabschnittspartner Antony in Kambodscha abserviert – in einer zugegeben für sie äußerst heiklen Situation aber mit einer lange aufgebauten Egozentrik und Arroganz, die sie bei anderen Menschen allzu oft kritisiert.
Es gäbe wohl noch einiges mehr zu kritisieren. Während der Lektüre von aWay stieg die Stöhnhäufigkeit bei mir deutlich an und das lag nicht (nur) an meinem hübschen Freund, mit dem ich im Lockdown-light mehr Zeit als sonst gemeinsam verbrachte. Ich bin aber sehr froh, dass ich diese Zeit mit ihm und nicht mit Nic Jordan verbringen muss, denn nach dem, was ich aus ihrem Buch über sie weiß, könnte ich es kaum erwarten, selbst loszutrampen. Wie gut, dass man nicht jeden Menschen und jedes Buch mögen kann und muss. Nic Jordans Buch packe ich jedenfalls aWay.
HMS
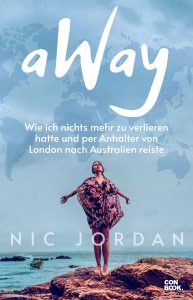
Eine Leseprobe findet ihr hier.
Jordan, Nic: aWay – Wie ich nichts mehr zu verlieren hatte und per Anhalter von London nach Australien reiste; 1. Auflage, September 2020; 416 Seiten, mit Bildteil; Paperback mit Einbanklappen; ISBN: 978-3-95889-368-9; ConBook Verlag; 16,95 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitstzeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun. Vielen Dank!
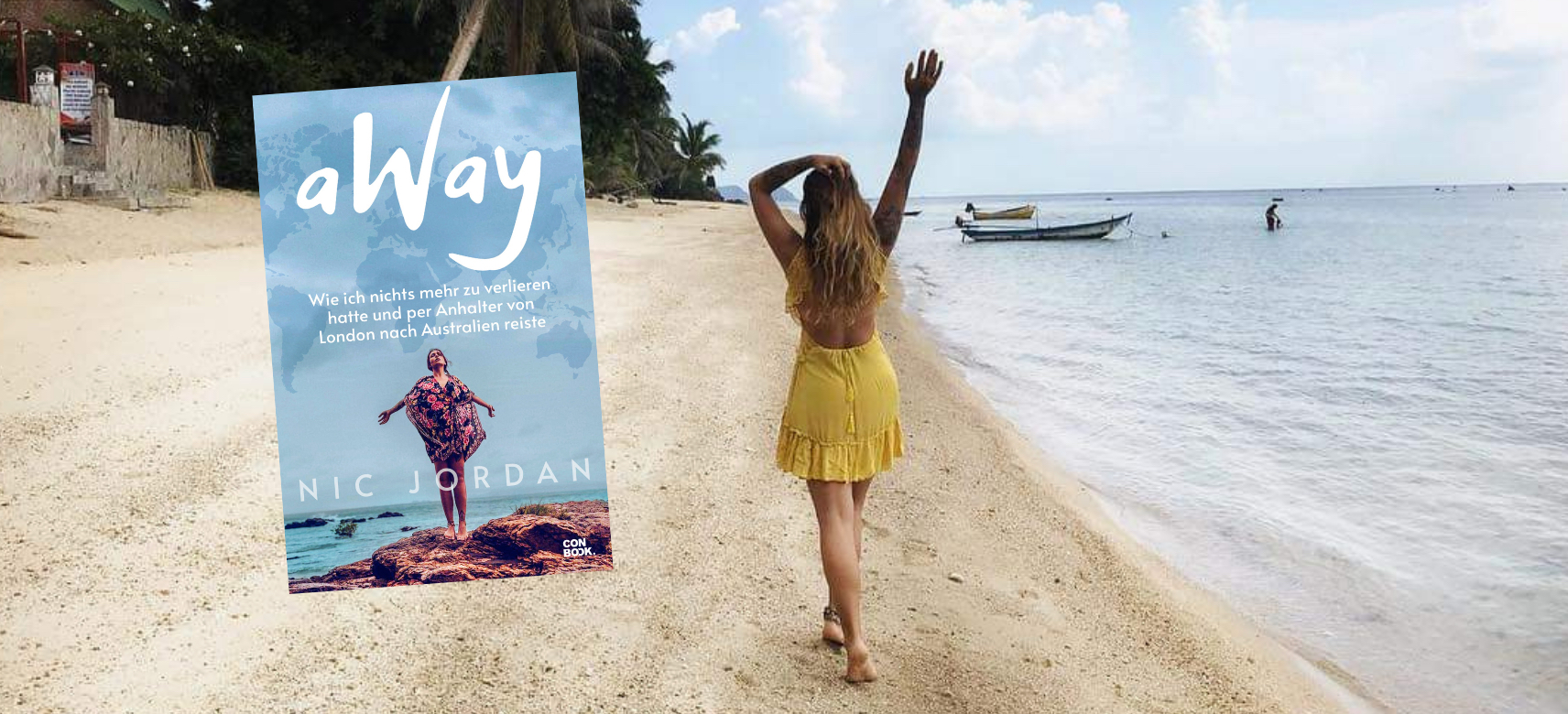



Comments