„Wie würde Europa heute aussehen, wenn es sich zunächst einmal selbst ganz ernsthaft und glaubwürdig beim Wort nehmen würde?“
S. 187
Diese Frage stellt der europäische Romancier und kulturkritische Essayist Robert Menasse zum Schluss, der kein Schluss sein kann, „denn wir befinden uns erst am Anfang der notwendigen Diskussion, wie wir aus der Krise der EU als einem europäischen Demokratieprojekt herausfinden können, um die Polykrise, mit der wir konfrontiert sind, zu bewältigen“, seines 38 Kapitel oder Gedankenpunkte umfassenden Essays Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde. Der im April im Suhrkamp Verlag erschienene Band darf als indirekte Antwort und/oder Erweiterung zu Stefan Zweigs Die Welt von gestern, worin dieser ein kosmopolitisches Europa vor 1914 beschreibt, gelesen werden.
Widersprüche gehören dazu
Dieses Europa verschwand peu à peu und dann mit einem großen Knall „dank“ Nationalismus und Faschismus. Nach 1945 gab es nun die Chance ein geeintes, friedliches, über- beziehungsweise nachnationales Europa zu bilden. Doch wieder sind es Nationalismus, Egoismus und nicht zuletzt Zynismus, die das große, historisch einmalige Friedensprojekt mehr und mehr gefährden. Systemische Widersprüche, Unvernunft sowie Kurzzeitdenken sind die Folge und/oder kommen hinzu.
„Die Rückkehr in eine Geschichte, die es nie gegeben hat (ein glückliches, ethnisch definiertes Volk lebt auf seinem Territorium in freier Selbstbestimmung in Frieden und allgemeinem Wohlstand und trotzt allen Stürmen der Geschichte). Eine Rückkehr ins Nie-Gewesene ist keine Zukunft. Der Nationalismus hat keine Zukunft. Aber er kann die vorläufige zerstören.“
S. 19
Mit alldem und mehr setzt sich Menasse in seinem Essay in gewohnt pointierter, analytischer, (selbst) reflektierender, manches Mal sich selbst widersprechender – „Wenn ich jetzt zurücklese, bemerke ich einige Widersprüche in meinen Gedanken. Das beruhigt mich. Widersprüche sind die Voraussetzung für Diskussionen.“ – Weise auseinander. Dabei bringt er Fakten und Fragen, Denkanstöße und Verwunderung, Anekdoten und Kritik auf wunderbar leichtfüßige und doch nicht verballhornende Art zusammen. Im Grunde könnte Die Welt von morgen als Essay gewordene Variante seiner Europa-/EU-Romane Die Hauptstadt und Die Erweiterung (ausgezeichnet mit dem Prix du livre européen aka Europäischer Buchpreis 2023 sowie dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2022) gelesen werden.
Niemand und Jemand ist Jedermensch
Menasse erläutert gut zugänglich die Entstehung des Europäischen Projekts, die ersten Gedanken eines auf Einigung und Gemeinsamkeiten angelegten Friedensprojekts – und wundert sich an anderer Stelle, wieso heute, bei Ressourcenknappheit, Niemand auf die Idee kommt im Gedanken an eine „Montanunion“ aus dem letzten Jahrhundert nun eine Art „Seltene-Erden-Union“ zu organisieren. Dann wiederum ergibt dies doch irgendwie Sinn, denn schließlich klappt es auch mit der Harmonisierung, also der „Angleichung der steuerlichen Regeln und Steuersätze in den EU-Staaten“ nicht so recht.
Wieso oben „Niemand“ großgeschrieben steht? Ganz einfach: Der an der tschechischen Grenze lebende Robert Menasse leitet seinen Europa-Band mit „Der Europäische Niemand“ ein. Dies ist eine Anfang des 18. Jahrhunderts erschienene Flugschrift, die den Autor faszinierte und die er nun durchdekliniert, um zu diesem Schluss zu kommen:
„Ich bin der Europäische Niemand, muss keine Überzeugten überzeugen, will keine Munition liefern für Wutausbrüche der Nationalisten, auch wenn wir uns mit der Wut vieler Bürger beschäftigen müssen. Ich will beflissen sein, Niemanden zu beleidigen. Zu Jedermanns Nutzen.“
S. 10
Zwar, das darf wohl gesagt werden, tritt Menasse sicherlich so manchen auf die Füße, doch beleidigend wird er durchaus nicht. Den Wütenden wendet er sich natürlich mehrmals zu und wundert, ja, ärgert sich gar, dass immerfort und fortgesetzt auf diese zugegangen und sich darum bemüht wird, sie dort abzuholen wo sie stehen, und also ihnen mehr oder weniger ein wenig nach dem Mund zu reden, statt sie wieder dorthin zu bringen, wo die (europäische) Demokratie, die Vernunft und das (diskursive) Miteinander stattfinden.
Punkt um Punkt
Apropos Demokratie: Ein kleinen, feinen Rant samt Erläuterung dazu, wieso Demokratie, verdammt nochmal, keine Staats- sondern Regierungsform ist, gibt es auch. Dringend not-wendig, um mal eine Menasse-Stilübung zu verwenden, wie ich meine, denn genau wie er, muss ich ständig auch in „Intelligenzblättern“ sowie diversen Nachrichten- und Satiresendungen von der Demokratie als „Staatsform“ lesen und hören. Leudde! Wenn’s wenigstens alternative Fakten wären… aber nein, es handelt sich nur um Ungenauigkeit oder Doofheit.
Weitere Punkte, die Menasse neben den bereits genannten herausarbeitet oder viel mehr an denen er sich in erster Linie abarbeitet, sind das Pathos nationalistisch geprägter Regierender, die, um Wahlen im Land zu gewinnen, das „Treten-Prinzip“ umdrehen und so nach oben (also Brüssel) treten und nach unten (also dem „Volk“) schleimen. Wahlen wollen gewonnen und Narrative aufrecht erhalten werden! Polen und Ungarn sind, oder im erstgenannten Fall bestenfalls „war“, so ein Fall; Österreich mit seiner (Kickl-)FPÖ sieht Menasse aus guten Gründen ähnlich kritisch. Andere Länder dürften folgen. Und wenn es um die nationalen wirtschaftlichen Interessen geht, ist eh kaum ein Land besser als das andere, um’s mal arg verkürzt wiederzugeben.
Die nicht rechtskonforme Allmacht der Staats- und Regierungschefs, also des Europäischen Rates, über die Kommission sieht er ebenfalls nachvollziehbarerweise mehr als kritisch und fordert in seinem Nicht-Schluss-Schluss folgerichtig, dass „[im Institutionsgefüge der Union […] wieder, wie es ja geplant war, das Primat der Kommission über den Rat sichergestellt werden“ muss. Ergo: Das Europäische Parlament bestimmt über den oder die Kommissionspräsident*in (vorher muss es eine Kandidatur gegeben haben) und „die Anzahl der national eingesetzten Kommissare muss, wie vertraglich vereinbart, reduziert werden.“
Völkerrecht für’n Arsch
Eine sehr feine, nachdenklich stimmende, vor allem weil logisch und nachvollziehbar aufgebaute, Argumentation liefert Menasse zum Thema „Volk“ beziehungsweise Demokratie, die in einem Staat, also Territorium fixiert sein muss und macht dabei direkt einmal „Woodrow Wilsons Doktrin des >>Selbstbestimmungsrechts der Völker<<, die ins Völkerrecht Eingang fand und zu einem Grundaxiom der Charta der Vereinten Nationen wurde“, den Garaus. Denn:
„Wer Ethnie und Territorium zusammendenkt, befürwortet nolens volens ethnische Säuberungen auf einem bestimmten Territorium, Umsiedlungen, die Überhöhung der eigenen Idee von sich selbst und das Schüren von Konflikten gegen andere, gegen innere und äußere Feinde, nicht zuletzt Terror gegen Minderheiten, aber auch gegen Kritiker der nationalen Mythen, nicht zuletzt mythischen Überhöhungen eines >>Kernlands<< oder eines >>angestammten Gebiets<< außerhalb der aktuellen Staatsgrenzen.“
Das ist so naheliegend, dass es beinahe erschreckend ist, wie wichtig es ist, dass Robert Menasse es derart deutlich zu formulieren hat und fortfährt, dass es gerade dieser Gedankenweg war, der Lenin und Stalin „so leichten Herzens dieser Doktrin“ zustimmen ließ. Menasse arbeitet in seiner Welt von morgen mit reichlich Beispielen, was die Ernsthaftigkeit seines Anliegens untermauert und geneigten Leser*innen sicherlich das eine oder andere Material für kommende Diskussionen mit „europakritischen Pro-Europäern“ an die Hand gibt.
Wie hältst du’s mit deinen Sonntagsreden?
„Pro-Europäer“ – auch so eine Bezeichnung, die dem Autoren eher säuerlich aufstößt. Der Begriff „proeuropäisch“ bedeute zunächst gar nichts, bis nicht dazu gesagt werde, wie die Person, die ihn verwendet, denn zur europäischen Idee stehe und was sie europapolitisch wolle. Da wird die Luft dann schon dünner. „Subsidiaritätsprinzip“, das von der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher in die Welt gebrachte Müllwort „Nettozahler“, den „Vereinigten Staaten von Europa“ oder eben der oft genannten, nie verfolgten „Harmonisierung“ – all dies Begrifflichkeiten, auch gut für Sonntagsreden, an denen Menasse sich reibt.
Plumpe Symbolpolitik ist noch so ein Triggerpunkt für den in Wien geborenen, jüdischen Menasse. Er zeigt sich irritiert bis verärgert darüber, wie die politische Linke den Nationalismus für sich entdeckt und fragt sich, wie die Geschichte es eines Tages bewerten wird, wenn Linke nun sozialistisch und nationalistisch zusammendenken. Ebenfalls so genannte, sehr flexible, wohlfeile Werte und stellt auf die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni bezogen die Frage: „Was muss eine ‚Postfaschistin‘ tun, um in einer Union von Staaten, die immer weiter nach rechts rücken und immer radikalere nationalistische Politik machen, Befürchtungen nicht zu zerstreuen?“ Autsch.
„Wollust durch nationales Fieber“
Nicht selten hält er uns einen Spiegel vor. Denn seien wir mal ehrlich – haben wir diese in Talkrunden, Zeitungsbeiträgen, Nachrichten- und Wahlsendungen sowie Online-Kolumnen ganz selbstverständlich verwendeten Begriffe nicht längst selbst übernommen und verwenden wir sie nicht häufig ebenso selbstverständlich wie gedankenlos? Tja.
Speziell wenn es um „uns“, also Deutschland geht, steht auch die Frage im Raum, ob „wir“ irgendwann in der Lage sein werden, den Schlaaaand-Führungsanspruch und den Willen zu unbedingter Größe und Einflussnahme hinter uns zu lassen. Die Selbstbeweihräucherung bei gleichzeitigem Selbstmitleid, dass „Du bist Deutschland“ in Kombination mit dem Gedanken, nicht relevant genug zu sein. Immerhin ist ja jetzt wieder Fußi-EM! Wir können also wieder richtig Deutsch-Sein, uns „der Verzückung an sich selbst, der Wollust durch das nationale Fieber“ hingeben, wie der treffend grantelnde Menasse mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 schreibt.
Persönlich ausgewogen
Bei all den auf nicht einmal zweihundert Seiten aufgebrachten Gedanken, erörterten Kritikpunkten, sowohl an der EU als Institution wie auch diversen Staaten, könnt’s uns beinahe schwindelig werden. Doch schafft Robert Menasse es in Die Welt von morgen den Sinn und Zweck der Lektüre und eingehenden Beschäftigung der verschiedenen Punkte augenscheinlich werden zu lassen. Okay, zugegeben, das mag das Schwindelgefühl erst recht befördern.
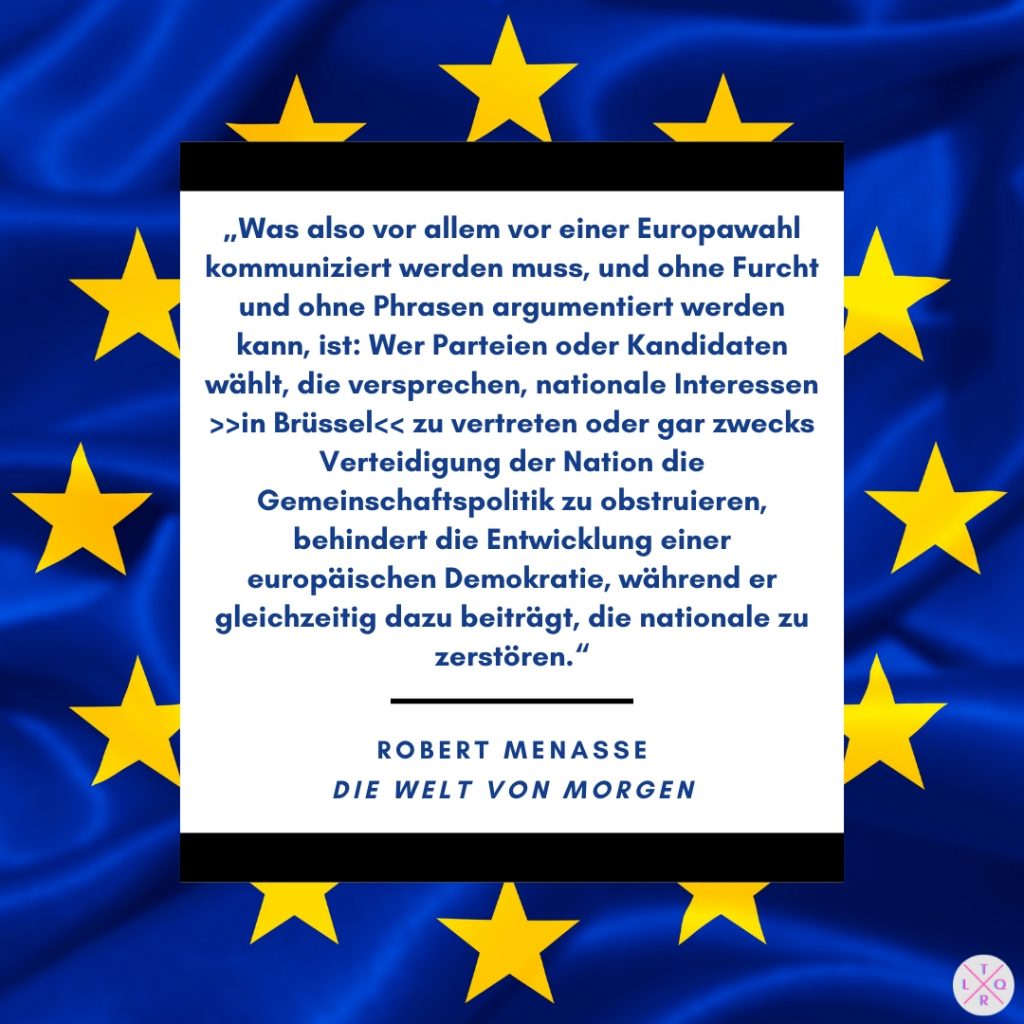
Im Ernst: Menasse schreibt vieles, argumentiert schlüssig (was mitnichten bedeutet, dass ihm bei allem zugstimmt werden müsse; ganz im Gegenteil, er fordert ja immer wieder Debatte, Diskussion, konstruktiven Streit) bis bissig, aber nie verbissen. Sollte mensch nicht schon ganz weit im Abseits stehen (Ha! Fußballmetapher!), dürfte es Niemanden geben, der diesem klugen, weitsichtigen und im besten Sinne engagierten, weil auch sehr persönlichen (ein nachnationales Europa etwa ist Menasse schon seit langem ein Anliegen, wie wir auch in diesem Band erfahren), Essay nichts abgewinnen kann.
Ob Europawahljahr oder nicht – eine lohnenswerte Lektüre und wunderbare Grundlage für die Diskussion über ein „Wie“ und „Wie mehr“ von Europa.
AS
PS: Stark auch, wie Robert Menasse die nicht einklagbare Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die durchaus justiziable Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) einander gegenüberstellt.
PPS: „7. Ist das Glas also halb voll oder halb leer? Wie mich diese Phrase nervt! Es geht doch darum, ob wir die Möglichkeit haben, nachzuschenken!“
PPPS: Allein „die ideelle Gesamthymne des Friedensprojekts EU“ lohnt den Erwerb.
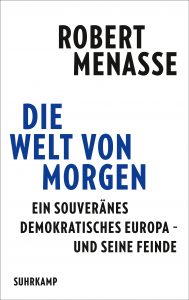
Eine Leseprobe findet ihr hier.
Robert Menasse: Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde; April 2024; 192 Seiten; Hardcover, gebunden mit Schutzumschlag; ISBN: 978-3-518-43165-8; Suhrkamp Verlag; 23,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!

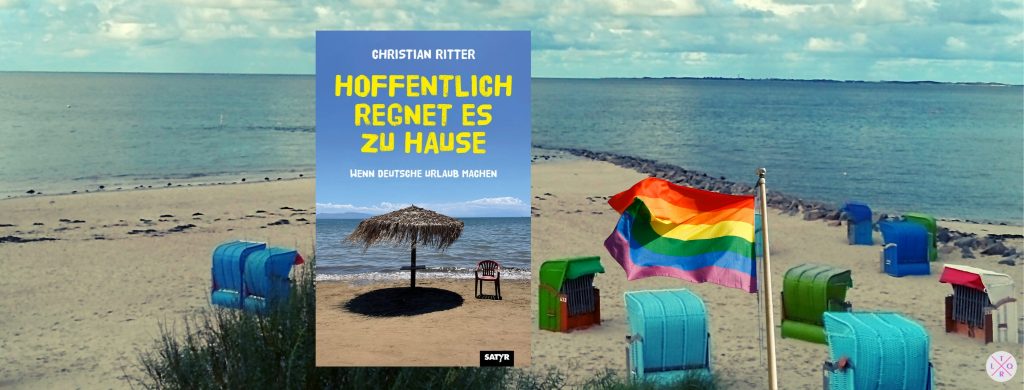


Comments