Beitragsbild: Queere Menschen schwenken die Prideflag aus ihren Fenstern; Montevideo, Uruguay, September 2020 // Foto: DanFLCreativo via Canva
Manuela Kay gibt sich in ihrem Essay „Sehnsucht nach Subversion“ angriffslustig und argumentationsstark und kommt am Ende ins Träumen.
Von Nora Eckert
Wer in den Berliner Bezirken Kreuzberg und Neukölln aufgewachsen ist wie Manuela Kay, der kann eigentlich nur die richtigen Antworten fürs Leben gelernt haben. Und wie uns ihr im letzten Jahr im handlichen Taschenformat im Querverlag erschienener Essay zu verstehen gibt, ist es eigentlich noch wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen. Sie tut es jedenfalls mit subversivem Trieb – und es darf auch wehtun.
Bleiben wir für einen Moment beim Biographischen, denn im letzten Jahr erschien ein weiterer Aufsatz, in dem sie Auskunft über sich gibt. Dort erfahren wir, dass der Weg ins Leben und durchs (Nacht-)Leben in ihrer Jugend allerdings nicht nur von einem politisch-lustvollen Programm gesteuert, sondern ausgerechnet vom Fahrplan der Berliner Verkehrsbetriebe diktiert wurde. Nennt man das Ironie des Schicksals oder Hedonismus nach Fahrplan? So war das jedenfalls in den noch lustvollen frühen 1980ern kurz vor der Katastrophe namens AIDS.
Wie hemmend und hinderlich das gesellschaftliche Leben und der öffentliche Nahverkehr für Queers damals war (für die es noch gar nicht den Begriff gab), beschreibt Kay in ihrem Beitrag „Warten auf die erste U-Bahn“ in dem Band Westberlin – ein sexuelles Porträt* (kurze historische Fußnote: Wo der Bindestrich bei West-Berlin früher fehlte, war ideologisch der Osten, weil der Westen natürlich wusste, dass Berlin eine Stadt mit zweiHälften ist, während der Osten eine „selbständige politische Einheit“ neben der „Hauptstadt der DDR“ zu sehen glaubte, der Irrtum wurde bekanntlich pünktlich zum 40. DDR-Jubiläum korrigiert).
Kay erzählt auch, wie schließlich ein motorisiertes Zweirad eine revolutionäre Verkehrs-Wende für sie brachte: „Mittlerweile hatte ich mir auch endlich ein Motorrad zugelegt – ein Traum, den ich lange gehegt hatte und der mein lesbisches Selbstverständnis gewissermaßen vervollständigte. Dank meiner kleinen Honda hatte nun auch die ewige U-Bahn-Warterei ein Ende, und ich konnte noch mehr Zeit in Bars und Clubs verbringen!“
Was Manuela Kay seither lebt, das ist gesellschaftliche Sichtbarkeit als Lesbe. Sie moderierte im Rundfunk und wirkte mit beim Programm des schwul-lesbischen „Eldoradio“, drehte lesbische Pornos, war Chefredakteurin bei der Siegessäule, organisiert und kuratiert seit vielen Jahren das PornFilmFestival Berlin, ist inzwischen Verlegerin der Siegessäule und des L-Mag und schreibt erfolgreiche Bücher wie Schöner kommen. Das Sexbuch für Lesben. Ihr Charme, so habe ich es bei ihr kennen- und schätzen gelernt, ist von einem stets sprungbereiten ruppigen Selbstbewusstsein geprägt – wir kennen das auch als raue Schale und weicher Kern.
Zurück zum Essay, der den Untertitel „Ein Weckruf“ trägt. Wer bitte schön soll geweckt werden? Und wer will das überhaupt? Ich fürchte, der Essay erreicht wahrscheinlich nur diejenigen, die ohnehin schon wach sind, weil sie – wie Kay – einen inneren Wecker besitzen, der bei „normal“ automatisch Alarm auslöst. Worum geht es eigentlich? Zum Beispiel, vom Normal-Sein Abstand zu nehmen. Oder Kritik zu üben an der „Werteverschiebung innerhalb der LGBTIQ*-Community“, die da heißt „Anbiederung an die heterosexuelle Normgesellschaft“ und „Unterwerfung unter ihre Werte“. Da es jedoch nicht dieCommunity gibt, wären für die einzelnen Fraktionen sehr unterschiedliche Problemlagen zu diskutieren – das nur am Rande. Aber führt der Weg zur Anerkennung wirklich nur über eine Art Tarnstrategie? „Ich tarne mich, indem ich mich so gebe, so lebe und so aussehe wie sie“, heißt es dazu im Text.
Als Transfrau verlange ich selbstverständlich Anerkennung, ohne auch nur im Traum daran zu denken, der binär-heteronormativen Mehrheitsgesellschaft deshalb eine Deutungshoheit über mich zuzugestehen. Es geht dabei um Gleichberechtigung oder anders gesagt, um die Anerkennung der Gleichheit der Menschen in ihrer Verschiedenheit. Die Verschiedenheit ist Realität, die Gleichheit vorerst noch Ziel, bei der die Subversion ihren Einsatz findet, ein ungerechtes System zum Einsturz zu bringen. Natürlich will ich verdammt normal sein, was denn sonst, aber in der Normalität des trans*Seins und mit dem Bewusstsein, dafür keine Binarität nötig zu haben. An dieser Stelle wäre dann doch genauer hinzuschauen, für und gegen wen Kay argumentiert, wendet die Transe hier mal skeptisch ein.
Allergisch reagiert Kay auch auf das Geliebt-sein-Wollen: „Gemocht und akzeptiert zu werden von den Mehrheitsheteros, von denjenigen, die in der Nahrungskette gefühlt über uns stehen – das ist für viele Homos anscheinend das größte Glück auf Erden und eine Art nachträgliche Legitimation, überhaupt auf der Welt sein zu dürfen. Wir – die wir ansonsten als feige Schwuchtel oder als böse Kampflesbe beschimpft werden, als Scheißtranse oder als Bi-Maus oder generell als perverse Sau herabgewürdigt – wechseln durch brave Anpassung und gehorsames Ablegen der Attribute wie böse oder pervers gewissermaßen die Seiten.“ Dazu passt, wie sie sich über die Homo-Ehe echauffiert, über die patriarchalen Heiligtümer Monogamie und Kleinfamilie. Das ist alles bedenkenswert und ernst zu nehmen, und dem ich mich in großen Teilen anschließe.
Freilich wollen alle Menschen geliebt werden. Wer das Gegenteil behauptet, lügt oder wird schon geliebt oder weiß nicht, was damit gemeint ist. Auch Manuela Kay will geliebt werden, sonst hätte sie nicht den Essay geschrieben und alles andere in ihrem Leben angestellt. Wer gibt, will immer auch etwas zurückbekommen. Wahre Altruisten sind so rar wie Heilige (und die werden auch nur gemacht).
Klar, an wen die Kritik adressiert ist: An die Angepassten, die ihren Frieden mit dem Patriarchat und dem Kapitalismus gemacht haben, und die vor fünfzig Jahren schon Rosa von Praunheim mit dem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt im Visier hatte. Das waren jene Schwule, die den Spießer nachahmten, indem sie sich politisch passiv und konservativ verhielten „als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden“ (R.v.P.).
Gut, aber was machen wir jetzt mit der Subversion? Denn ich teile Kays Sehnsucht nach Subversion ohne Einschränkung, wobei mir nicht ganz klar ist, ob auf ihrem Abrissplan auch die Binarität steht, mit der Schwule und Lesben eher selten Probleme haben. Die Annahme der Kritischen Theorie (hier Theodor W. Adorno), es gebe kein richtiges Leben im falschen, hat jedenfalls von seiner Wahrheit nichts eingebüßt. Kann das aber heißen, wir bauen uns unsere kleine subkulturelle Insel (was wir heute gerne Blase nennen), setzen auf Parallelgesellschaften und Nischen? Gründen wir eine LGBTIQ*-Muster-Kolchose, mit der wir der Mehrheitsgesellschaft die kalte Schulter zeigen?
„Aber echte Freiheit und tatsächliche Unabhängigkeit können besser aufrechterhalten werden, befindet man sich in eigenen Strukturen – wie beispielsweise der schon beschriebenen Subkultur. Nicht in der Bar – obwohl dort natürlich auch -, sondern praktisch in einem eigenen kleinen politischen und gesellschaftlichen Ökosystem, das nicht mit in den Abgrund gerissen wird, wenn die Gesellschaft in selbigen fällt.“
Liebe Manuela Kay, in genau diesen würde auch Dein kleiner queerer Öko-Schrebergarten fallen. Deshalb: Subversion funktioniert nicht nach innen, sondern nach außen – und da draußen ist die Gesellschaft, in der es Verbündete gibt und in der Abriss-Koalitionen möglich sind. Und ja, „Subversion macht Spaß, ist sexy und kreativ“. Und auch da treffen wir uns: „Wir wissen es besser und haben alle Voraussetzungen dafür, unser Leben viel eigener, individueller, kreativer und unangepasster zu gestalten. Wir haben gewissermaßen genetisch das Zeug dazu, die Welt zu verbessern.“
Der Essay jedenfalls passt in den Plan zur Weltverbesserung, denn er vermag unsere Denkmaschine auf Hochtouren zu bringen.
Nora Eckert ist Publizistin und Ausführender Vorstand bei TransInterQueer e. V.

Manuela Kay: Sehnsucht nach Subversion, Band 3 der Reihe in*sight/out*write; September 2021; 64 Seiten; Klappbroschur auf Strukturkarton; ISBN: 978-3-89656-305-7; Querverlag; 8,00 €
* Unsere Besprechung zu Westberlin – ein sexuelles Porträt lest ihr bald.
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!

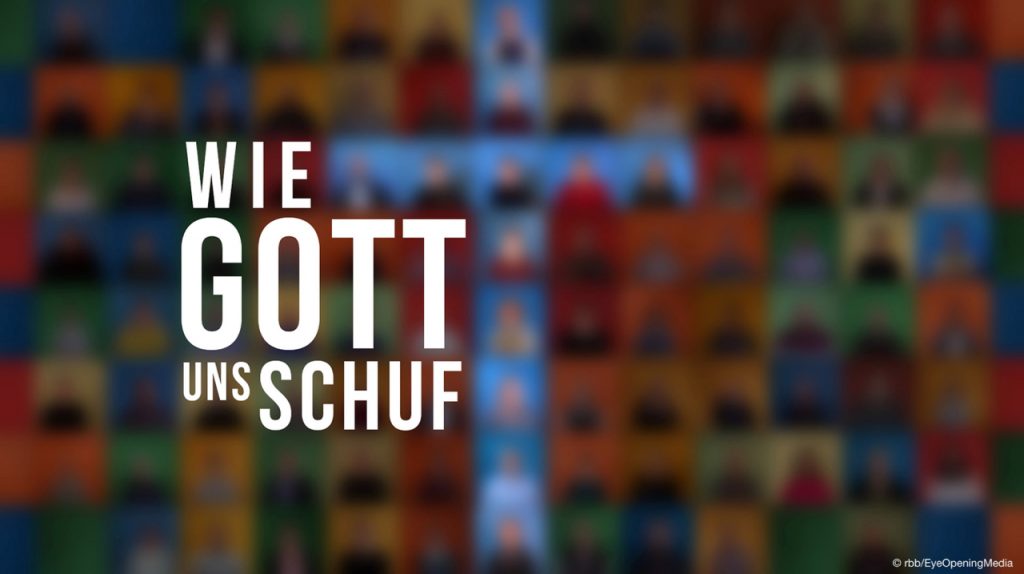


Comments