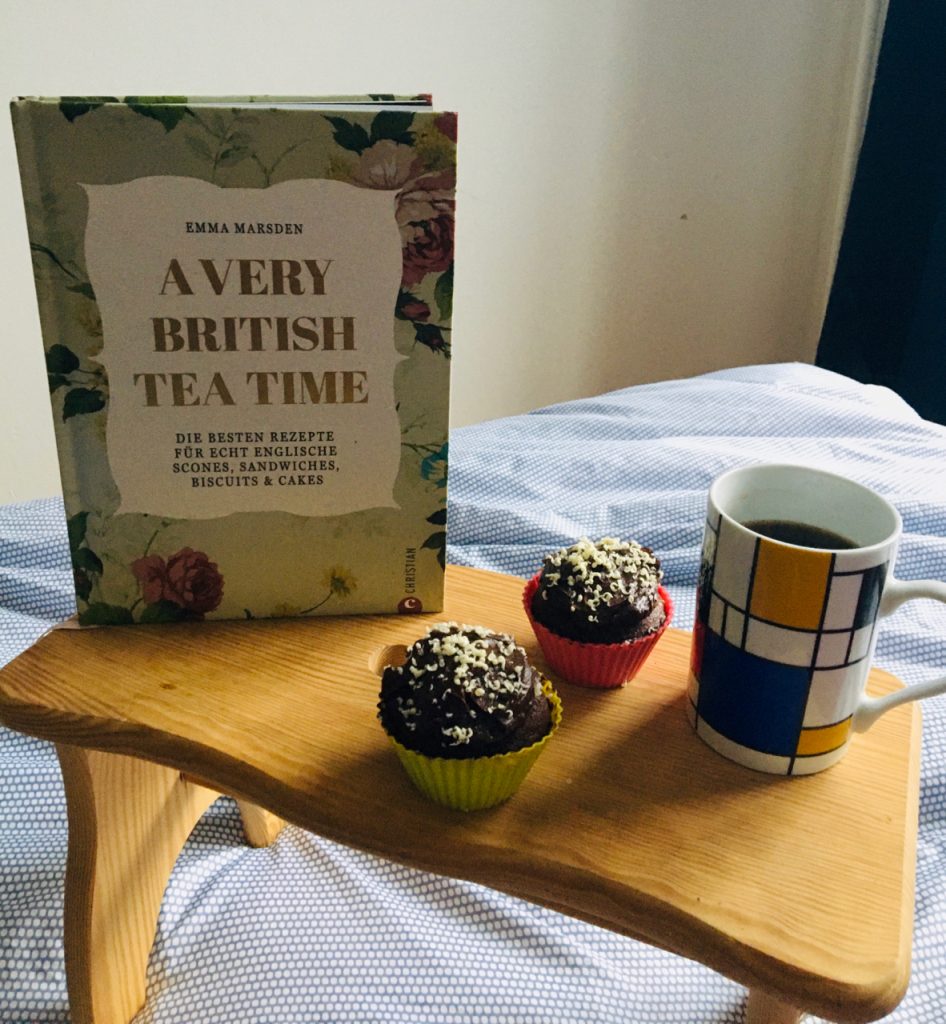Theodora Becker ist mit „Dialektik der Hure“ ein fulminantes Werk über den käuflichen Sex gelungen. Sie zerlegt die bürgerliche Moral als Ideologie, erklärt geschichtlich, wie aus Prostitution Sexarbeit wurde und warum die Bezeichnung Hure emanzipativ ist.
Von Nora Eckert
Nein, man dürfe Sexarbeit nicht auf Gewalt und Dienstleistung reduzieren und Verbot sei die falsche Konsequenz aus einer völlig verfehlten, weil ideologisch kontaminierten Prostitutionsdebatte, erklärte die Politik- und Kulturwissenschaftlerin Theodora Becker in einem Interview. Und dass sie damit recht hat, dafür legt sie zum Beweis eine fast 600 Seiten starke, historisch angelegte Analyse zum Thema vor, die letzten Endes auch „die Verteidigung einer Faszination“ sein will – erschienen bereits im letzten Jahr im Verlag Matthes & Seitz.
So schwergewichtig dieses Buch daherkommt, so bleibt der Fokus doch auf die weibliche Prostitution gerichtet. Es ist kein globaler Blick, der beispielsweise auch die männliche Sexarbeit miteinschließt oder etwa das Thema trans. Letzteres gewann in den 1980er Jahren politische Bedeutung in der Hurenbewegung, verbunden mit der Frage, ob trans*Frauen mit dazugehören. Am Ende führte die Kontroverse zur Spaltung der Berliner Organisation Hydra. Doch das nur am Rande. Denn das schmälert keineswegs den enormen Erkenntnisgewinn, den uns Beckers Arbeit beschert, zeigt aber, dass die Genderfrage beim Thema Prostitution wohl noch unbeantwortet ist.
„Dieses Buch handelt von der Hure, aber mehr noch von der bürgerlichen Gesellschaft“, beginnt die Autorin, um danach in aller Ausführlichkeit und mit einer immensen Materialfülle das Thema in sechs Kapiteln auszubreiten. Tatsächlich geht es um Befunde über den Zustand der bürgerlichen Kultur. Denn in deren sich verändernden Sicht auf das Thema Prostitution spiegeln sich zugleich die eigenen moralischen und ethischen Widersprüche etwa in Fragen der Sexualität wider. Man landet immer schnell bei einer grundsätzlichen Ideologiekritik an der vermeintlich „guten Gesellschaft“, für die beispielsweise Geld als Äquivalent „personaler Werte“ gilt.
Das war schon eine Erkenntnis des Philosophen und Soziologen Georg Simmel, der seine Zeit um 1900 ideologiekritisch durchleuchtete und Interessantes zum Thema Käuflichkeit zu Tage förderte. Die Abgrenzung von Haben (Verkäuflichem) und Sein (Unveräußerlichem) werde aufgeweicht und „ist in der bürgerlichen Gesellschaft prinzipiell unscharf“, lesen wir Becker, woraus immer wieder abstruse Vorschläge erwachsen, wie mit Prostituierten umzugehen sei. Suspekt blieben sie schon deshalb, weil sie die Sexualität öffentlich machen und die Monogamie in Frage stellen.
Da gab es beispielsweise 1905 den Vorschlag, Lusthäuser einzurichten als eine Mischung aus Fabrik und Klinik, gewissermaßen Häuser zur „Samenentleerung“. Das Ganze streng kontrolliert, durchorganisiert und ärztlich beaufsichtigt. Frauen sollten darin als konsumierbarer Teil „eines riesigen Befriedigungsapparats“ den Männern zur Verfügung stehen. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, welche obskuren Fantasien damals kursierten.
Solche Institutionalisierung mit dem Ziel einer Disziplinierung der Frauen war die eine Seite der bürgerlichen Prostitutionspolitik, die andere bestand in der Abschreckung durch Verächtlichmachung, Kriminalisierung und strikte Ausgrenzung. Parallel dazu gab es immer auch die Theorie der sozialen Nützlichkeit und Notwendigkeit. Denn die Prostitution ermögliche die Abfuhr von überschüssigem Sexualtrieb. Und da Sexualität gern als etwas Schmutziges gesehen wurde, erhielt die Prostitution die Bedeutung der Kanalisierung dieses Schmutzes.
Die funktionalistische Prämisse der bürgerlichen Ideologie fand sich übrigens eins zu eins in der vermeintlich neuen Moral des Kommunismus wieder. Es sei zumindest so lange eine notwendige Einrichtung, solange der Kapitalismus herrsche. Mit der Überwindung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung würde auch die Prostitution verschwinden. Wohl nicht der einzige Irrtum des Kommunismus oder später des real existierenden Sozialismus mit einer florierenden Prostitution auf der Jagd nach Devisen.
Interessant auch, was Becker über den „Gemischtwarenhandel“ der Prostitution mitzuteilen weiß, verbunden mit der allzu berechtigten Frage, was die Hure eigentlich genau verkaufe und der Freier erwerbe „und ob es sich dabei überhaupt um dasselbe handelt“. Die Hure bewerbe, was ja eigentlich nicht zum Kauf anstehe, nämlich sie selbst. Beckers Vorschlag:
„Die Substanz der Hurerei, so meine These, ist nicht die Ausführung, die Verrichtung einer Handlung, sondern deren Verheißung. Die Geschäftsmoral eines ehrlichen Tauschhandels, Geld gegen Dienstleistung, entspricht weder ihrem Wesen und ihrem Narrativ als Grundtopos der Kulturgeschichte. Über bloße Verrichtungen würde niemand reden, geschweige denn Poeme, Dramen oder bunte Zeitungsseiten erdichten.“
Es geht also um die Inaussichtstellung der Erfüllung von Wünschen:
„Die Ware der Hure kann nicht erwerben, wer sie nicht selbst erzeugt. Das Arbeitsmaterial der Hure sind die Fantasien der Freier.“
Becker bringt es hier auf den Punkt und benennt zugleich die Faszination an der Sache, die eben mehr sei als pure Sexarbeit. Ich denke, auf ein so unsicheres Terrain begibt sich nur, wer mehr als die Fachliteratur kennt.
Ich habe es bisher nicht erwähnt, aber Theodora Becker ist nicht nur eine akribisch und kritisch arbeitende Wissenschaftlerin, sondern sie verfügt ebenso über einen sehr persönlichen Zugang zum Thema. Das macht sie geradezu privilegiert. Sie arbeitete selbst zehn Jahre lang als Sexarbeiterin und weiß demzufolge aus erster Hand, worüber sie spricht, ohne je der Gefahr der Romantisierung zu erliegen. Im Gegenteil, man spürt unverkennbar in Beckers Darstellung gerade der selbst erlebten Gegenwart – bei aller gebotenen Wissenschaftlichkeit – eine besondere Erdung und einen wohltuenden Realismus. Dazu gehört das Wissen, dass es noch etwas hinter den Fakten gibt.
Auch das eine Qualität dieser Studie, die vielleicht nicht gerade ein breites Lesepublikum finden wird, aber zumindest bei all jenen Pflichtlektüre sein sollte, die sich angeblich für kompetent halten, in der Prostitutions-Debatte mitreden zu können. Zu befürchten bleibt allerdings, dass all die falschen Argumente in dieser Debatte, die Becker souverän zerlegt und widerlegt, eine erschreckende Hartleibigkeit auszeichnet. Nicht ganz uneitel möchte ich auf einen eigenen Beitrag verweisen, der unter dem Titel „Sex im Angebot“ bei literaturkritik.de erschienen ist.
Nora Eckert ist Publizistin, im Vorstand beim Bundesverbandes Trans* e.V. und bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society

Veranstaltungshinweis: Sonntag, 16. Juni 2024, 16:00 Uhr, Mehringhof, SFE Raum 2, Berlin: Theodora Becker spricht im Rahmen der Linken Buchtage über ihr Buch Dialektik der Hure. Von der ›Prostitution‹ zur ›Sex-Arbeit‹.
Eine Leseprobe findet ihr hier.
Theodora Becker: Dialektik der Hure. Von der ›Prostitution‹ zur ›Sex-Arbeit‹; November 2023; Hardcover, gebunden; 591 Seiten; ISBN 978-3-7518-2009-7; Matthes & Seitz; 34,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!