Die Feministin und Schriftstellerin Erica Fischer erzählt in „Spät lieben gelernt“ ihr Leben mit unverstellter Offenheit, schnörkellos und ehrlich und landet damit mehr als nur einen Punktsieg.
Von Nora Eckert
Ihre sprachliche Nüchternheit ist von großer Eindringlichkeit, die wirklich verblüfft. Sie ist einer der vielen Gründe, weshalb mir die Autorin sofort sympathisch war, und ich ihren Lebensbericht, diese Berg- und Talfahrt der Empfindungen, gar nicht mehr weglegen wollte. Sie hatte einst zu dem Film Aimée & Jaguar, der 1999 in die Kinos kam, die Buchvorlage geschrieben – Buch und Film wurden ein Riesenerfolg. Aber beides ging damals, warum auch immer, an mir vorbei, und so war mir der Name Erica Fischer bislang unbekannt. Ich wusste also nicht, was mich mit dieser Autobiografie erwarten würde.
Beim Lesen fand ich dann noch viele Gründe mehr, diese Autorin sympathisch zu finden, die Anfang des Jahres übrigens ihren 80. Geburtstag beging. Sympathisch, was sie in und aus ihrem sehr wechselvollen und engagierten Leben alles gemacht hat. Überhaupt ihre Offenheit fürs Leben und für andere Menschen, die meist nicht On the Sunny Side of the Street leben, und schließlich ihre Offenheit als Feministin. Die ist mit Blick auf genderkritische und radikale Feministinnen keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, was mich in jüngster Zeit immer wieder auf Sicherheitsabstand zu gewissen feministischen Gruppen hat gehen lassen. Sie ist da wohl mehr auf der Seite jener, die wissen, dass Feminismus alle etwas angeht.
Sympathisch auch ein Bewusstsein, mit dem sie die zwei Grundübel für die Ungleichheit der Menschen und für die Geschlechterdifferenz von Frau und Mann nie aus dem Blick verliert, nämlich das Patriarchat im Bund mit dem Kapitalismus und allem, was darin als Rassismus, Kolonialismus und Misogynie eingeschrieben ist. Sympathisch ebenso (und hier fühlte sich mein Lokalpatriotismus sogleich angesprochen), dass sie sich für Berlin als Wohnort entschieden hat – ich teile gerne meine große Liebe. Ebenso sympathisch ihre Empathie für trans* (leider alles andere als eine feministische Selbstverständlichkeit), wovon allerdings in der Autobiografie nichts zu lesen ist, sondern in einem Kapitel eines ihrer zahlreichen Bücher (Feminismus revisited, wo sie von ihrer Begegnung mit der iranischen trans*Frau Parisa Madani erzählt), was ich natürlich sofort in der Bibliothek nachlesen musste.
Und ebenfalls sympathisch, dass sie sich an Oswald Wiener, den Kybernetiker und avantgardistischen Schriftsteller (die verbesserung von mitteleuropa) erinnert, wer kennt den eigentlich noch?, der 1969 vor der österreichischen Justiz nach West-Berlin flüchtete und hier das Lokal „Exil“ eröffnete, das am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg lag, und wo sie Wiener Schnitzel aß. Einer meiner Freunde wohnte gleich um die Ecke und das „Exil“ wurde so für uns zu einer Art gastronomisches „Asyl“ auf der Flucht vor Currywurst und Boulette, wo nämlich richtiger Tafelspitz serviert wurde und was sonst noch als typisch Österreichisch in der Küche gilt. Das war Anfang der 1970er Jahre absolute Exotik in Berlin, die wir dankbar annahmen – und später abgelöst wurde vom „Austria“ am Marheinekeplatz (war dort aber seit Jahrzehnten nicht mehr und übernehme keine Garantie).
Offenbar hatte die Pandemie auch ihre guten Seiten. Zumindest verdankt sich das Buch dem durch die Lockdowns verordneten Rückzug aus dem sozialen Leben mit der Folge von Langeweile, aber auch mit dem Freisetzen von Schreibenergien. Und so erfahren wir über Erica Fischers Kindheit in England, ihre ziemlich konfliktbeladene Familiengeschichte, in der emotionale Nähe oder gar Liebe so gut wie nicht vorkommen („Wenn meine Mutter Gefühle zeigte, wurde ich zu Eis.“), wir lesen über ihr Erwachsenwerden, ihre Politisierung, ihren Einstieg in den Feminismus und wie sie 1972 Mitgründerin der Aktion unabhängiger Frauen (AUF) in Wien wird.
Sie will keine Kinder, eine bewusste Entscheidung – sie wollte, Barbara Duden zitierend, kein „Versorgungssystem für meinen Fötus“ werden und war heilfroh, als ihr mit Vierzig endlich die Gebärmutter entfernt wurde. „Ich war die Bürde der Weiblichkeit los“, kommentiert sie lakonisch. Und an anderer Stelle: „Schon als Kind muss ich gespürt haben, dass es nicht gerade von Vorteil war, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren zu sein.“
In ihrem Sex- und Liebesleben gab es Männer und Frauen. Doch hatten ihre Männer, die sie fand, immer ein Problem mit der Nähe. „Alle Männer, mit denen ich seit Ende der 1970er Jahre liiert gewesen war, hatten mich verlassen. Auch die Frau, mit der ich etwa ein Jahr lang eine geheime, in meiner Erinnerung glückliche Beziehung hatte […].“ Doch das blieb nicht so – sie hat das Lieben gelernt, nur eben spät. Doch dazwischen kam das Älterwerden und konfrontierte mit ganz anderen Erfahrungen, die sie in ihrem Buch Jenseits der Träume. Frauen von Vierzig beschrieb. Der Spiegel an der Wand wurde zum Feind, aber nur deshalb, weil sie ihren Körper selbst zum Feind erklärte. So sehe ich das zumindest. Die Verwitterung des Alters, die welke Haut, die Runzeln – man kann das als Mängel auflisten, aber auch selbstbewusst annehmen, denn das Forever Young war schon immer eine Lüge, nicht aber die Schönheit des Alters. Um die sehen zu können, braucht es Demut.
Beeindruckend das Kapitel über ihre jüdische Familiengeschichte. Ihre Mutter habe immer behauptet, „erst Hitler habe sie zur Jüdin gemacht“. Aber das stimme nur auf den ersten Blick, wie wir durch Fischers Erzählung erfahren. Auch eine wohlhabende Familie in Warschau wie die ihrer Mutter habe den polnischen Antisemitismus als Alltag erfahren. Die erste Frage in Polen sei immer gewesen: Jude oder nicht Jude. Und die antisemitische Ausgrenzung war in allen Lebensbereichen gegenwärtig. „Bezeichnenderweise begann ich mich erst in Deutschland für meine jüdische Herkunft zu interessieren“, erklärt sie. Ihre Eltern sind ja gerade deshalb nach England emigriert, um der Verfolgung zu entgehen, wobei ihr Vater nicht jüdischer Abstammung war. Was dann nach dem Krieg auch den Grund lieferte, nach Wien zurückzukehren.
Erica Fischer kam in den 1970er Jahren über den Journalismus zum Schreiben. Es war keineswegs eine Leidenschaft, aber die Lust zum Schreiben blieb dann doch und hat ihre Werkliste bis heute ziemlich lang werden lassen und erst recht, wenn wir noch die zahlreichen Übersetzungen hinzurechnen, die auch zu ihren Beschäftigungen gehören. Und weil ich am Anfang all die Gründe aufzählte, warum sie mir so sympathisch ist, will ich zum Schluss noch einen weiteren Grund hinzufügen: „Solange wir noch lesen können, leben wir.“ Der Satz ergänzt aufs trefflichste mein 11. Gebot: Gehe nie ohne Buch aus dem Haus.
Und hier noch einmal Erica Fischer: „Doch in Berlin fühle ich mich zu Hause. Ich habe in dieser Stadt gearbeitet und Freundschaften geschlossen, ich hatte Liebhaber und habe in verschiedenen Bezirken gewohnt. Vermutlich werde ich hier sterben.“ Aber das hat noch Zeit.
Nora Eckert ist Publizistin, im Vorstand beim Bundesverbandes Trans* e.V. und bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society

Erica Fischer: Spät lieben gelernt. Mein Leben; Oktober 2022; 224 Seiten; Hardcover mit Schutzumschlag; ISBN 978-3-8270-1472-6; Berlin Verlag; 22,00 €
Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!



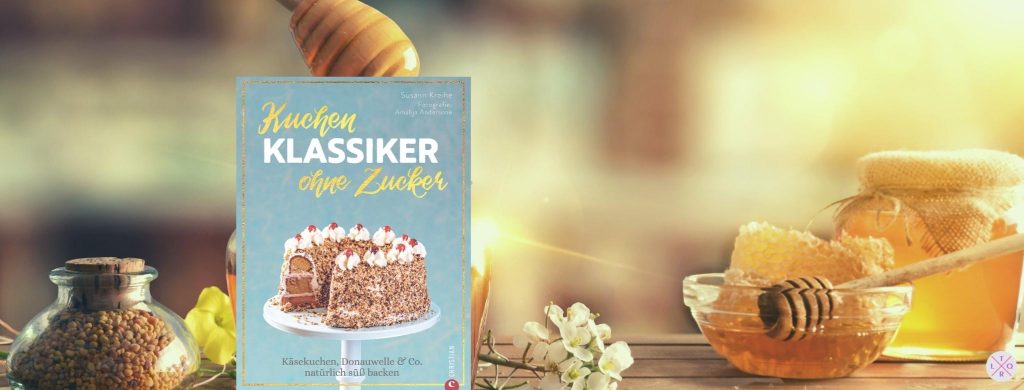
Comments